Atempause und Horizonte
six album covers, six sleeves of desire.
six landscapes of sound, six places to be transported to.
six choices, which is the place you wanna live in?
Ich stromere, streife. Ich durchforste und springe hin und her. Ich sitze still. Ich stöbere durch die Seiten des Fotobuches „Time Passes Slowly“, das Teil der edel gefertigten Schatzkiste „Another Self Portrait (1969-1971) – The Bootleg Series Vol. 10“ beiliegt. Bob Dylan zuhause mit Hund und Gitarre, im Studio, quiet days, eine Phase des Driftens, nach einer Serie von „milestones“, nach dem Skandalgriff zur elektrischen Gitarre, nach seinem Motorradunfall. „Self Portrait“ wurde damals meist verrissen, und wie so oft, erkannten viele erst dann eine spezielle Qualität, als es von den riesigen Erwartungen entkoppelt wurde, die mit ihm, schon lange kein „complete unknown“ mehr, einherhergingen. Ich mag einige Lieder mehr, einige weniger, das eine und andere Juweil mischt sich ins Bootleg. Dieses Fotobuch hat es mir besonders angetan, denn da trifft man Dylan in einer Zwischenwelt an, einen Mann, der sich ins Private zurückzieht, Freude empfindet am Alltag jenseits des grossen Geschehens.

„Time passes slowly“ – in den kommenden vier Tagen muss das komplette Skript der Klanghorizonte“ stehen, der Redakteur braucht meinen Stoff zum Redigieren, vor seiner Reise nach Berlin. Ich habe heute noch Jans O-Ton zu „Manafon Variations“ bekommen, zwei Stunden lang aus den frisch eingetroffenen „audio files“ von Marcie Stewart einen OTON für die Stunde zusammengestellt und übersetzt, ich bin eine kleine Bergrunde gelaufen, habe nun unter den ersten Teil des Skript einen Haken gemacht, die Zeitmarker gesetzt, in Dylans „coffee table book“ gestöbert.

Die Zeit vergeht langsam und wie im Flug. Mein Freiraum, mein Herumstöbern, mein „lazy afteroon“, und da fällt mir gleich Mark Doyles toll geschriebenes Buch über die Kinks ein, denen er sich so facettenreich nähert, wie es einem versierten Historiker möglich ist, und der darin der tiefergelegten Dynamik von Ray und seinen Gesellen auf die Spur kommen möchte, in der Welt, die sich ihnen damals auftat. Ich bin noch im Eröffnungskapitel; nach seinem jüngsten Büchlein über John Cales „1919“ ist Mr. Doyle eine echte Entdeckung. Und die Kinks sowieso für mich ein gefundenes Fressen.

Also, wunderliche Stunde des Nichtstuns. Lass mal die Märzhorizonte fallen bis morgen, und beginne mit den ersten freien Assoziationen zum übernächsten Mal, im Mai. Von ECM wird es dann wohl einen Titel geben, für mich das schönste Album, dass Bennie Maupin je als Leader gemacht hat, „The Jewel In The Lotus“. Und morgen landet die neue Scheibe von Geir Sundstol im Postkasten, einmal mehr aus dem Haus Hubro. Unlängst bekam ich zum Streamen und Runterladen ein spannendes Projekt aus dem Reich der langem Schatten, die Don Cherry immer noch wirft. Die Erforschung eines archaischen Steinkreises mit alten Instrumenten von Don und Moki, aus ihren Jahren in Schweden.

Und wie passend es da wäre, auch jene geniale Platten des Taschentrompetenmagiers zu spielen, die nach 1971 nie wieder auf einen Tonträger gepresst wurde, die „Relativity Suite“. Das fügt sich sogar nahtlos ins Umfeld von Bennie Maupins Meisterstück: nie aus dem Kopf ist mir die Erinnerung des Perkussionisten Adam Rudolph gegangen, der als Jugendlicher Zeuge im Schaltraum war, als Bennies Platte in New York aufgenommen wurde, ja, genau, dieser Adam Rudolph von „Hu! Vibrational“, sowieso einer der grössten Fans von Don Cherry unter der Sonne. Atempause und Horizonte. Wer neue Alben entdeckt, die einen besonderen Zauber entfachen, und die zwischen Ende März und Mitte Juni erscheinen, von Drag City bis Nonesuch, von Red Hook bis Punkt Editions, von Intakt bis Clay Pipe Music und Frederiksberg Records, möge Laut geben. No hurry, time passes slowly!
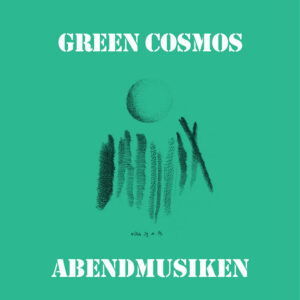
Green Cosmos? Das Besondere dieses mir bislang unbekannten Albums aus dem Jahre 1983, das schon seinerzeit nur privat in kleiner Auflage gepresst und vertrieben wurde, ist keinesfalls eine unerhöre Mischung von Stilen. Manches ist hier vertraut als Anklang von Bill Evans bis MCoy Tyner, und das Quantum Kalimba reicht nicht aus, um der Zeit von damals voraus zu sein. Alle Jungs kannten ihren Coltrane, besonders die Quartett-Alben, und hin und weg waren sie nach eigenen Angaben von John Handys „Indo-Jazz“ namens „Karuna Supreme“, einer schönen Schwarzwald-Produktion des Labels MPS. Das Besondere ist gar nicht leicht auf den Punkt zu bringen, und beruht auf der immensen Spielfreude, die nie überdreht und stets massvoll bleibt, mit einer frappierenden Leichtigkeit des Ausdrucks. Ich hätte damals meine helle Freude gehabt, diesen gesammelten Unaufgeregtheiten zu folgen, und hole das nun gerne nach, dank einer weiteren Ausgrabung der Schatzjäger von Frederiksberg Records: „Abendmusiken“! Die Aufnahmequalität sehr fein, und dass die Jungs hier alles, was sie kennen, in die Stücke hineinlegen, und etwas von dem, was sie nicht kennen, bringt etwas Unerhörtes ins Spiel! Mojo vergibt vier Sterne, Downbeat drei, ich dreidreiviertel – eine wirklich fesselnde Entdeckung!(am 1. April ist die überarbeitete Fassung dieses Textes bei unseren „monthly revelations“ zu finden, in der Abteilung RADIO…. A propos, die BINGE-Rubrik verschwindet und wird durch TIME TRAVEL ersetzt. Gezeichnet, das FlowFlow HQ!)
Ein vollkommen Unbekannter?
Eben auf der großen Kinoleinwand James Mangolds A Complete Unknown angeschaut (in deutschen Kinos hat er albernerweise den „deutschen“ Titel Like A Complete Unknown). Der Film ist bzw. hat mir deutlich besser gefallen, als ich erwartet hatte. James Mangold ist im Allgemeinen nicht als großer Künstler bekannt, auch nicht als Autorenfilmer, eher als solider Handwerker, der jeden Stoff auf eine zugängliche bis gefällige Weise publikumsfreundlich zubereitet – und damit regelmäßig für die Oscar-Saison fit macht. Und auch A Complete Unknown ist erwartungsgemäß durch und durch konventionell und zudem ein solider Historienfilm – zwei Aspekte, die ich sonst nicht besonders mag, wenn ich ins Kino gehe. Doch davon abgesehen ist das Ganze sogar bemerkenswert weniger gefällig, als ich befürchtet hatte. Vor allem wird doch ein großer Fokus auf die Musik, auf die Songs gelegt, anfangs von Pete Seeger, Joan Baez und Woody Guthrie, dann aber auch auf den frühen Dylan. (Im Fall des Maria-Callas-Films Maria von Pablo Larraín hatte irgendeine Zuschauermeinung, die ich las, einen solchen erzählerischen Fokus auf gut ausgewählte Musikstücke letztlich als nachteilig ausgelegt, absurderweise.) Und sowohl damit als auch mit der inszenatorisch und schauspielerisch dann doch bemerkenswert und überraschend unsympathischen Darstellung der Filmhauptfigur Dylan macht der Film bei einer zweieinhalbstündigen Laufzeit keine großen Zugeständnisse an ein Mainstream-Publikum. Andererseits erklärt eben das auch ein wenig, warum Dylan selbst dem Film seinen „Segen“ gegeben hat, da er bekanntlich kein großer Fan von freundlichen Huldigungen seiner Person ist. Wenn man Dylan als Person vorher nicht mochte, wird man ihn nach dem Kinobesuch garantiert nicht sympathisch finden: Das macht der Film auf jeden Fall sozusagen richtig und wird dem Enigma damit gerecht.
Zudem werden etliche Figuren und Umstände, die heutigen jungen Menschen, zumal außerdem der Vereinigten Staaten, sicher kein Begriff sind, ausführlich erzählt: Die Figur Joan Baez hat ein wenig die etwas undankbare Rolle als attraktive Stichwortgeberin und Anhimmlerin der Hauptfigur; letztlich ist sie sogar die sympathischere Figur als Dylan; ihr Charisma vermittelt die Schauspielerin sehr gut, wenn die echte Joan sicher komplexer und weniger „nice“ war (wie man auch aus dem jüngsten autobiografischen, überaus sehenswerten Dokumentarfilm Joan Baez – I am a Noise entnehmen kann). Auch die Dylan-Freundin „Sylvie Rosso“, der man klugerweise nicht den echten Namen Suzie Rotolo gegeben hat, bleibt ein wenig unterkomplex als Dylans frühe große Liebe und wichtiger Einfluss in der New Yorker Kunstszene, wobei letzteres aber nur für Aufmerksame wirklich erzählt wird. Edward Norton allerdings füllt die in den USA bis heute kulturgeschichtlich legendär relevante Figur Pete Seeger oscar-reif mit Leben. Und Timothée Chalamet ist tatsächlich auch wirklich stark in der Hauptrolle, wie ich ihn bisher in keinem Film gesehen habe. Es ist sicherlich eine exzellente Regie-/ Besetzungsentscheidung, einen allgemeinen Sympathieträger in dieser schwierigen Rolle zu besetzen; sonst würde ein unvoreingenommenes Publikum vermutlich so eine Geschichtsstunde nicht knapp 150 Minuten lang durchhalten. Dafür sind viele Details in der Geschichte und der Figurenzeichnung eben doch sehr spezifisch für Musiknerds oder Menschen, die die 1960er noch miterlebt haben, sowie für den kleinen Kreis von Leuten, die sich für das doch recht spezifische Thema einer solchen Künstlerfigur und ihrer Nöte begeistern können. (Ich kann davon ein Lied singen…) Trotz der Laufzeit wurde mir keine Minute langweilig; ich hätte sogar eine ganze Serie mit diesem Material angeschaut, war fast traurig, dass es irgendwann zu Ende war.
Und dann sind da natürlich diese unfassbar großartigen Lieder, die das Ganze zusammenhalten. Denn der Film ist, ungeachtet des thematischen roten Fadens, der sich doch ganz wunderbar auch in Todd Haynes‘ ungleich kreativeren Dylan-Film I’m not there wiederfindet, dann letztlich eine große Verbeugung vor diesen Songs und ihrer bis heute bleibenden Relevanz, sowohl für die Zeitgeschichte (im Sinne eines Historienfilms über die frühen Sechziger), die Musikgeschichte (in Anbetracht des übergroßen Einflusses bzw. Wertschätzung, den/die Dylan bis heute bei 99% aller Songwriter genießt) als auch für die Kulturgeschichte im größeren Sinn. Große Klasse, wie Chalamet (und im übrigen auch die Tonmischung!) diese Songs zum Leben erweckt. Das ist alles andere als selbstverständlich.
„What can ordinary be“ (on a sunny afternoon)
Ich bin viel zu sehr am reinen Hören interessiert, um je ein besonderes Faible für Songvideos entwickelt zu haben, aber dieses ist eine Ausnahme von der Regel, ganz gleich, ob man Song und Bilder werkimmanent deutet oder biographische Fakten hinzuzieht. Als es mir noch vorschwebte, Deutschlehrer zu werden, interessierten mich beispielsweise die diversen Interpretationsverfahren, Herr Gadamer und der „hermeneutische Zirkel“ so sehr wie die Freuden der Konkrete Poesie (ich belegte Proseminare zu beiden Themen, und sehe noch heute Ernst Jandls „Laut und Luise“ auf meinem Nachttisch in Münster liegen, neben einer alten Tonbandmaschine mit vielen Leonard Cohen-Liedern und einer Sendung von Winfrid Trenkler über Soft Machine).
Auf jeden Fall ist Robert Forsters „Butterflies“, geschrieben mit ohne seine Lebensgefährtin Karin Bäumler, und dargeboten „at home“ mit Karin und einer aufmerksamen Katze im Garten (oh, Fusel klopft gerade ans Fenster und will eine kurze Sommerpause einlegen), ein Meisterstück, was filmische Inszenierung, Song und Lyrics betrifft. Mir erscheint es auch alles andere als weit hergeholt, hier eine Spur Ray Davies zu wittern (so wie mir bei einem Song von Alabaster DePlumes neuem Werk Schwingungen einer Platte von Donovan in den Sinn kommen namens „Wear Your Love Like Heaven“).
Einmal, als die beiden Go-Betweens mir gegenüber sassen, erzählte ich ihnen, wie ich ihr allerwrstes Album im Nördlichen Bayerischen Wald hörte, mit dem langen Song als Favoriten, und dass es nur ein Katzensprung von Grasfilzing nach Regensburg war, früh in den Achtzigern. Ich nannte „understatement and passion“ die „basics“ in ihrem Songbuch. So viele Jahre später jetzt. Hier, in diesem Song ist das wieder so eine spezielle Mischung: unendliche Nonchalance auf der einen Seite, das Dunkle, Unheimliche schimmert auf der anderen durch, genauso wie eine weiter zurückliegende magische Zeit: man kann es werkimmanent betrachten, Biografien als Folien drüberlegen. Selbst Lee und Nancy würden staunen und einen Sommerwein entkorken.
(m.e.)
The spirit of Emily Dickinson, other powerful ingrediences of „Manafon Variations“, and more – ein Interview mit Jan Bang und Erik Honoré

Michael: You and Jan were only in parts involved in the making of „Manafon Variations“, but your impact on some tracks was very strong. How do you see the place of this album in David Sylvian‘s work?
Erik Honoré: Looking back on Died in the Wool – Manafon Variations, I see it as an extension and deepening of the world Manafon created – a work that retains the starkness and unpredictability of the original, but introduces new layers of texture, arrangement, and atmosphere. While Manafon was characterized by its raw, almost documentary-like approach to improvisation, Died in the Wool reshapes and recontextualizes those elements, offering a more sculpted and immersive listening experience. The album highlights David’s ongoing willingness to revisit and reinterpret his work, allowing new voices and techniques to subtly shift its meaning.
Michael: As I remember, you and Erik found a deep source of inspiration in David Sylvian‘s solo albums from start on. Do you still return to them every once in a while, or is it so much in your visceral memory that it is more a living presence in your unconscious? And do you have a favourite album? Mine was always „Brilliant Trees“…
Jan Bang: After a performance at Cafe OTO last summer, Nina, my wife and I had a coffee in London with Yuka Fujii, David’s long time creative partner. She mentioned her favorite track, the title track from Brilliant Trees. It builds heavily on Jon Hassell’s work around that time of Possible Musics , Dream Theory in Malaya and Aka Darbari Java. David told me about the recording process and meeting Jon who was 15-20 years his senior. Having the vision of how the combination of the organ chords and Jon’s trumpet would be intertwined. I guess vision combined with a great deal of stubbornness is needed to come out on the other end of a recording session with something interesting. I love that track and the unusual combinations. David has a unique way of finding the right people at the right time. Then make something out of it.
Erik: Brilliant Trees was important to me when it came, as a transition from pop and surface to something more profound, but his third solo album Secrets of the Beehive has always been a particular favourite. I feel it represents the essence of all of David’s approaches and influences up until that point, in a distilled form. Natural, seamless and free, both musically, lyrically, and sonically. There’s a clarity to it, a kind of effortless depth, that makes it feel timeless. I do return to his early solo albums from time to time, but in many ways, they’ve become more of a „living presence in my unconscious“, as you say. Their atmosphere, their emotional and sonic landscapes, are so deeply ingrained that they don’t need to be consciously revisited—they just exist as a reference point, a shared language, a sensibility that still can be drawn upon in new ways.
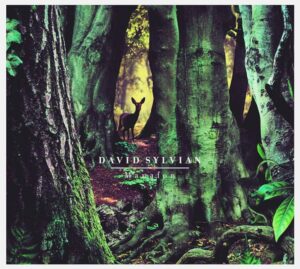
Michael: There was a change of direction in David’s work with „songs“ that started with „Blemish“ and its remix album. Free improvisation, so-called „free jazz“ and other aounds beyond the mainstream entered his work up to „Manafon“ and „Manafon Variations“. For many listeners this was a watershed, like the one of Talk Talk when they made „Spirit Of Eden“ and „Laughing Stock“. On „Manafon“ David inspired a group of improvisors to build the foundation of the album with a series of free improvs. Afterwards he sang over carefully assembled parts of it. On „Manafon Variations“ the process was the other way round. His singing already existed and was to a great extent the starting point for finding new surroundings for the voice. Was this quite a creative challenge?
Erik: I wouldn’t describe it as a challenge so much as an inspiration, a „roadmap“ – something that provided direction rather than resistance. It was a cross between producing and creating that felt both familiar and inspiring, something that we had already explored in other collaborations with David, where I was more strongly involved than on on Manafon Variations. The process was very much about finding new landscapes for his voice, building something around his existing vocal performances.
That approach—creating a sonic world in response to his voice—was something we also did on Do You Know Me Now, where we constructed the arrangement around his guitar/vocal demo, and on Uncommon Deities, which had a spoken-word foundation. You are of course right: David’s shift toward free improvisation and more abstract forms of music, starting with Blemish, was certainly a turning point, as significant as Talk Talk’s transition from The Colour of Spring to Spirit of Eden—a leap into something raw, instinctive, and far removed from traditional song structures.
But while Manafon built its foundation from collective improvisation, Manafon Variations flipped that approach: His voice was already there, and the task was to build an environment around it. That process wasn’t about overcoming obstacles; it was about discovery, about allowing the music to emerge in response to something that was already present.
Michael: Let‘s come to two pieces you were involved in. One example: „A certain slant of light“. How did you approach the piece? At the last passage, there was this beautiful instrumental coda with Arve‘s trumpet.
Jan: This part was created using existing samples of Arve, performed on my sampler in the Punkt Studio. I’ve long since moved the studio location, but thinking of this piece I can clearly visualize the recording space. Performing these trumpet samples, turning them around, the sampler is a shapeshifter. Something that could not necessarily have been done by recording Arve Henriksen´s trumpet directly. Different techniques create different results.

Michael: Then there was this piece „I Should Not Dare“. The words by Emily Dickinson. In my review at the time i wrote, i could imagine this being a 20 minute track, it is so relaxed and condensed at the same time, rich in details and poetic impacts, „an index of pissibilites“ so to speak… Can you say something about the way this little thing grew to its kind of perfection…. And a memory of working on it (with the ghost of Emily Dickinson around…)?
Jan: We struck gold with that specific piece. Christian Fennesz had done a guitar overdub on David’s basic vocal/acoustic guitar recording and sent it to me. I added the surroundings: the sudden bass note, the synth sample I had from a concert with Ståle Storløkken, the strings etc that changed the harmonic structure in certain selected parts. It is very open in terms of „sound population» for the lack of a better word. It breathes.
Michael: Now „Manafon Variations“ received their first ever vinyl edition, as a double album. I think, what once was confusing the listeners‘ expectations (who wanted to listen more classic songs) today seems much more accessible, easier on the ear even for new listeners. It may be the last album of David, the singer, but it is surely not coming from the ivory tower. Do you agree?
Erik: I do agree. When Manafon and later Died in the Wool – Manafon Variations were first released, they challenged many listeners’ expectations. But over time, I think these albums have settled into a different place in his catalog, where their accessibility is no longer measured by traditional structures, but by the immersive quality of their soundworlds. Perhaps that’s a reflection of how our ears and expectations have changed, or maybe it’s just the natural way music finds its audience over time.
If this does turn out to be the last album of „David, the singer,“ it’s certainly not a work from an ivory tower. There’s too much humanity in it, too much presence and engagement with sound, with words, with the musicians he surrounded himself with. For me, the experience of collaborating with David Sylvian on various projects was never about making something remote or impenetrable—it was about responding to something deeply personal and expressive. And I think that’s why the music still resonates. It asks something of the listener, but it also rewards in ways that continue to unfold long after the first encounter.
Michael: Looking back, how was that teamwork with David going on in regards to the two pieces I asked you about? Fighting? Easy going?
Jan: Really easy going and given total freedom from David’s side to express ourselves. However, on a personal level I am most happy about the Emily Dickinson piece which is only based on small samples that form a mosaic of colors.Erik: The collaboration with David on Died in the Wool, and for me personally even more on Uncommon Deities, flowed very naturally. One of the things that made working with him so rewarding was the balance he struck between creative freedom and extremely precise feedback. He has this ability to provide razor-sharp, informed guidance—never imposing, but always illuminating. His comments are never vague; they are direct, insightful, and always about serving the essence of the music. That combination of trust and precision made the processes not just easy-going, but deeply inspiring. His approach isn’t about control, a „top-down“ approach, but about bringing clarity to the work—helping to shape and refine ideas without limiting their potential. That’s why these long-distance collaborations never felt like a struggle or a negotiation; they felt organic, like a conversation where each exchange moved the music forward in a meaningful way.

Michael: A last question. It is very impressive how David Sylvian explores the range between speaking and singing. I think, this adds to the magic very much. At one point, maybe on the last piece, he is even singing straight away, like in a song from the older days, but only two verses as a counterpoint…. On other tracks there is a very thin line between spoken word and singing….
Erik: David’s ability to explore the space between speaking and singing is one of the compelling aspects of his artistry. It’s a space where emotion is distilled, where meaning is heightened, and where the listener is drawn in by the sheer intimacy of his delivery. On Died in the Wool, there are moments where his voice almost slips into what we might call a “classic song” structure, only to pull back, reminding us of the deliberate tension he plays with. This ability to move fluidly between expressions adds to the magic, creating a sense of expectation and, at times, an almost ghostly presence. That same sensibility is something Jan and I have also encountered in our collaborations with Sidsel Endresen. We are so privileged. Sidsel, like David, has an unparalleled instinct for phrasing, tone, and texture—she can make a single, wordless syllable feel monumental. Both of them push the boundaries of what a voice can be, making every moment feel necessary.

Postscriptum: PARTS OF THIS INTERVIEW WILL FIND THEIR WAYS INTO KLANGHORIZONTE (DEUTSCHLANDFUNK) MARCH 27, 9.05 p.m. / That radio hour can be heard a week long after airplay at Deutschlandfunkfunk, and, at another place, forever and a day (but only, If the „5 hour production“ on March 26 will live up to my expectarions). Many thanks to Erik and Jan for entering memory lane and offering so much insights! Apart from this day within our blog diary, this conversation will be part of our monthly revelations in April. With a slightly changed sequence of photos and covers.
By the way, the last albums by or with Jan Bang and Erik Honoré can be found on Bandcamp and PUNKT EDITIONS incl. Erik‘s „Triage“, Jan‘s „Reading The Ear“, his duo album with Eivind Aarset titled „Last Two Inches of Sky“ (HERE an old radio hour with the two!) Sidsel Endresen‘s „Punkt Live Remixes, Vol. 2“ (LISTEN NOW!) or „The Bow Make“, a collaboration of Jan Bang and Daj Fujikura, the Japanese composer strongly involved in „Manafon Variations“. And HERE an old hour of Klanghorizonte with Erik‘s Triage album!
Eine ruhige, fesselnde Inszenierung

In der Ard Mediathek ist derzeit die beste deutsche Kriminalserie zu finden seit der zweiten Staffel der „Toten von Marnow“. Es beginnt wie ein „Allerweltstatort“, aber rasch merkt man, dass hier mit viel Diskretion, genauer Beobachtung, und einer grossartigen Nina Kunzendorf als Kriminaloberrätin, eine Ausnahme vom Mainstream zu erleben ist. Es menschelt nicht wie blöd, keine schrulligen Dienstleiter im Dauereinsatz.
Sowieso liegt der besondere Augenmerk auf der Spurensuche, der über einen langen Zeitraum sich ereignenden Spurensuche, der Erschöpfung des Teams. Sehr viel ist in kleinen Szenen zu erleben, der Humor so fein dosiert, dass er erstmals nach einer halben Stunde kurz in Erscheinung tritt. Und sich sowieso rar macht. Die Musik ist sensationell diskret, feingearbeitet, und ein zusätzlicher Anreiz der „Soko Sonntag“, wie einer der vier Teile getitelt ist, beizutreten.
Der grosse Fehler und Abzug in der B-Note beim zweiten Teil der „Toten von Marnow“, war, dass es am Schluss in Teilen unglaubwürdig inszeniert und geplottet wurde, etwas „over the top“ (anders als bei Staffel 1). Auch war der Soundtrack etwas zu grell. All das ist bei „Spuren“ wunderbar austariert.
Und einen kleinen Mundartkurs bekommen wir bei „Spuren“ kostenlos dazu geliefert. Aber keine Sorge, „pascht scho!“ Aber, ähem, sind wir da in der Gegend von Lauenburg im Hessischen oder Badischen? Egal. Leises grosses Kino. Based on true events. Ja, und ab und zu leiser Humor, zum Beispiel in der Szene mit Ermittler Bernd und dem Apfelkuchen von Muttern!
Ich kann dem Soundtrack gar nicht hoch genug loben. Es lohnt sich, wenn man die Serie sieht, zwischendurch auf das alustische Beiwerk zu achten, das hier keine Gegenwelt öffnet, keine zweie Story erzäht, aber sehr, sehr fein die jeweilig herrschenden Stimmungen auslotet, erweitert, vertieft.
(„Kleine Welt!“, möchte ich da ausrufen. Ein erhellender neuer Kommentar von Ingo macht uns mit der Region und dem Regisseur etwas vertrauter – bleibt die Frage, ob Ingo auch den Dialekt eimst beherrschte, als er dort einen Teil seiner Kindheit erlebte)
Thoughts about an interview in the making
Eine Weile, bevor David Sylvians „Manafon“ erschien, sprach ich mit dem Engländer über das Album, im hintersten Winkel eines Hotelflurs, neben schattigen künstlichen Pflanzen. ich hatte eine schwere Erkältung, und einen privaten Todesfall hinter mir, und wenn man als Journalist David Sylvian begegnet, trifft man in der Regel auf ein höfliches, sachliches Gegenüber – Herzlichkeit, funny stories, jede Form von Begeisterung, all das ist und war Mangelware bei meinen drei Treffen mit Sylvian. Auch bei jenen anderen, zu denen ich in bester Laune aufbrach. Eine Zeitlang war mein Interview auf seiner Samadhi-Sound Seite anzuhören, irgendwann verschwand es. Damals galt es erstmal genau zu verstehen, wie es David Sylvian überhaupt anging, über radikal freien Improvisationen seine Gesänge zu entfalten, und der guten alten Tante Song ein frappierend anderes Design bereitzustellen. Innerhalb von zwei, drei Jahren kamen zwei Alben heraus: „Manafon“ und „Died In The Wool – Manafon Variations“.
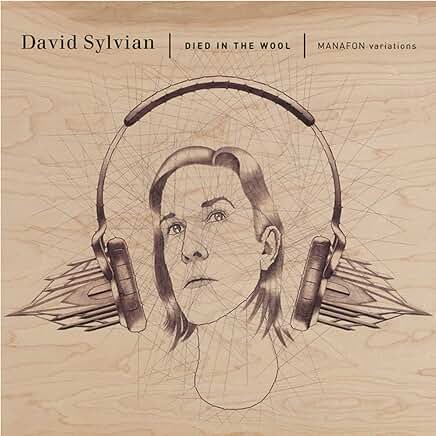
Vor wenigen Wochen erschien letzteres erstmals auf Vinyl, als Doppelalbum. Neue Mitspieler und Ko-Komponisten, andere Landschaften für seine Stimme auf ihren Erkundungsreisen durch eine dunklere Welt. Ich fand es nach all der Zeit verblüffend, wie leicht und schwebend ich diesen „twin albums“ folgen konnte. Egal, wie „noir“ manche dieser Stunden wahrer Empfindungen daherkamen, etwas Erhebendes geselllte sich diesen „Song-Meditationen“ bei. Ich befragte nun Jan Bang und Erik Honoré zu ihrem Anteil an den Variationen, und wie sie die Musik von damals heute erleben. Auch im Hinblick auf die Klanghorizonte vom 27. März, für die ich ein oder zwei Stücke der „Variationen“ fest eingeplant habe. Es wird wohl das letzte Album von David, dem Sänger, gewesen sein. In Kürze dann hier, wenn alles klappt, das Frage-Antwort-Spiel. Und die gern ausgeprochene Einladung, „Manafon“ und „Manafon Variations“ wieder mal in Ruhe auf sich wirken zu lassen.
Am Morsumer Kliff

Kaum gefährlich, ausser für Schwindelanfällige, der Rundweg durch eine uralte Landschaft, falsches Schuhwerk für die zwei matschigen Passagen, hinterher Zwiebelrostbraten von der Keitumer Landschlachterei, Nachbilder sich im Wind wiegender Ähren, Richtung Watt. Am frühen Nachmittag lausche ich dem neuen Album von Alabaster, und wähle hinterher aus dem Interview aus , was er über „tenderness“ sagt, über „healing“. Ohne einen einzigen falschen Ton – selbst die auf seiner Langspielplatte sind goldrichtig. Entwaffnend. Neben dem einen oder anderen Album für die Klanghorizonte ist Roger Enos „Voices“ aus dem Jahre 1985 on high rotation, hier in meiner Ferienwohnung. Eine Wiederveröffentlichung macht Sinn. Am besten zusammen mit dem anderen 1985‘er Werk aus den Grant Avenue Studios in Hamilton, Ontario, Michael Brooks „Hybrid“. Ich weiss noch, wie die zwei Langspielplatten im Sommer jenes Jahres erschienen (in meiner Erinnerung), und ich einen kleinen Text des Produzenten Brian Eno las, der von dem „impact“ von Klängen handelt, die abseits des „Angesagten“ entstehen.Big Change Is Coming
„Revolutionäre träumen tagsüber. Sie träumen vorwärts und zwar gemeinsam.“
Da kann man nur hoffen, dass die amerikanischen Protestler in diesem Modus sind. Arcade Fire geht das nicht schnell genug. Die kanadische Band klagt in ihrem Song „Generation A“: „I can‘ t wait wait wait wait, I‘ m not a patient man…“ Neil Young, mein „hero forever“, schreitet durch eine verschneite Winterlandschaft mit einem Blockbuster unterm Arm und verkündet laut und stark: „BIG CHANGE IS COMING“. Wir hören täglich die Horrornachrichten aus der untergehenden „free world“. War die mahnende Stimme der Erzbischöfin während einer Messe, in der Trump sass, er solle sich mässigen, die singuläre Aufstandsstimme, die ein bisschen Hoffnung machte? Reichen die Aktionen der entlassenen Ranger des Yosemite Park, die die amerikanische Flagge kopfüber aufhängten? Ist es eine Option, die USA zu verlassen, was Cher überlegt? Ich bin ein Kind der Protestsongs. Viele der Musiker, die damals engagiert waren, leben noch. Alt und müde? Nun ja, sie treten noch auf: Bobby, Bruce, Joan, Joni… Sich still zu verhalten bzw. sich zu weigern, den Namen des Wüterichs in den Mund zu nehmen, reicht nicht. Ich bin gespannt, ob bei der Oscarverleihung heute Nacht Protest- bzw. Solidaritätskundgebungen stattfinden. „MASTERS OF WAR“ hätte Programm sein können. Bob Dylan wäre der Visionär geblieben. Nun heißt der Film über ihn A COMPLETE UNKNOWN. Man darf gespannt sein, ob „Der Brutalist“ gegen den Dichter gewinnt.
Spiel mit dem Unbekannten – ein kleines Porträt von Paul Bley aus dem Jahr 1992
DER LINK
Dank des „Radiohoerers Henry“, und dank unserer Redaktionsassiatentin Martina Bedzent liegt nun der Link vor zu einer Ausgrabung aus den Archiven. Anno 1992. Als Einstimmung ein Text aus alten „Mana-Zeiten“:
Herzlichen Glückwunsch, wenn Sie dieses Trioalbum besitzen, in knisterndem Vinyl, mit Paul Bley, Bill Connors und Jimmy Giuffre. Sie haben eine Rarität in Händen, ein lang vergriffenes Stück Historie, einen kleinen Meilenstein. Ich bekam diese Platte, wenn ich mich recht entsinne, von Jazz by Post zugeschickt, meinem Pasinger Stammlieferanten für aufregenden Jazz in den 70er und frühen 80er Jahren. Carol Goss hat das Cover mit schneller Hand gezeichnet, in kurzer Zeit den Ideen in ihrem Kopf flüchtigen Halt geboten. Paul Bley hatte damals ein eigenes Schallplattenlabel ins Leben gerufen, Improvising Artists Inc. (I.A.I.). Auf einem anderen Werk spielte er an der Seite des Sun Ra -Companion John Gilmore. Und da war sein Solo-Piano-Album „Alone, Again“: ganz nah kam es heran an den Zauber seines Klassikers „Open, To Love“ (ECM). Ein Meister der Andeutung, der Pausen, des Ausschwingens einzelner Töne. Auf „Open, To Love“, erzählte er mir früh in den Neunzigern, in einem Bremer Hotel, wollte er (neben allem, wer da eine Rolle spielte, Carla (Bley), Annette (Peacock), ihre Präsenz, ihre Schatten, ihre kargen Kompositionen), die Hüllkurven von elektronischen Sounds auf dem Flügel nachempfinden. Aber zurück zu der anfangs erwähnten Schallplatte: „Quiet Song“ ihr Titel, und Sie sollten, statt jetzt eine Rezension zu erwarten (in der dann Worte auftauchen würden wie „skelettiert“, „leuchtend“, „Gesänge“, aber natürlich auch „Jimmy“ und „Bill“, dessen schönstes Soloalbum „Theme From A Gaurdian“ bitte bald von ECM wieder ans Tageslicht befördert werden möge), sich langsam, aber sicher auf die Suche machen nach dieser Produktion, vorausgesetzt, Sie mögen flüchtige, widerständige Töne!
Different kinds of ecstasy (2)
Als ich Weihnachten, im Jahr 1 nach dem Ende der Beatles, das Gatefold-Cover von „Blue“ aufklappte, waren dort (in meiner Erinnerung zumindest) alle lyrics zu lesen.
Und anders als später im Leben, als 30 Jahre Radio und Klanghorizonte das eher selten erlaubten, gab es Langspielplatten, die über Wochen den Plattenspieler blockierten. Mir fällt aus der Zeit nach den Kinks und den Beatles Chick Coreas „Return To Forever“ ein. Aber auch die erste aller Solopianoalben von ECM, Chicks „Piano Improvisations, Vol. 1“.
Im nachhinein ins Visier genommen (aber das Nachhinein ist nicht von Bedeutung), befördert die überragende Aufnahmequalität der Studioproduktion von „Blue“ oder den „Piano Imprivisations, Vol. 1“ das Empfinden, ohne Wenn und Aber einen einzigen Raum zu teilen…. die Stimme, der Zuhörer, die Gitarre, das Piano, das Kerzenlicht, die geschlossenen Augen – und sowieso der Wind aus Afrika…. ähnlich bei der über Seite 2 der Improvisationen schwebende Frage „Where Are You Now?“
„The wind is in from Africa, last night I couldn‘t sleep.“
Sowas von egal, ob es eine Chromdioxydkassette ist, „dead quiet“ Vinyl, dezent verrauschte Mittelwelle: im Innersten berührt zu werden, ist keine Frage der ultimativen Version. Es ist wie bei der Einnahme psychedelischer Substanzen oder bei luziden Träumen: Set und Setting müssen stimmen: kein Zauber ohne die Öffnung der Empfangsorgane, all die kleinen Rituale, sich einzustimmen.
In den nicht mehr so jungen wilden Jahren, hat es das eine und andere Album dann doch geschafft, nächtlicher wie täglicher Begleiter zu sein, round and round and round, 2019 zum Beispiel, Steve Tibbetts, „Life Of“. Manche erleben dieses Album des Mannes aus Minneapolis so, dass sich die einzelnen Stücke doch sehr ähneln, bis, ja, bis die Wahrnehmung in eine ganz andere Richtung kippt, und aus der ersten Enttäuschung wird oft genug erstmal eine Verblüffung, und dann ein konstanter „state of wonder“.
Singulärer insulärer Traumstoff.
„What game shall we play today?“
Die Zeit läuft.
Time runs fast.
Time passes slowly.