Jacques Tati
(English translation see here)

Jahrelang war er schon ziemlich vergessen: Jacques Tati. Kein Wunder, denn seine großen Erfolge lagen in den 1950er- und 1960er Jahren. Aber irgendwann, Mitte der 1970er war es wohl, da entdeckten ihn die Arthouse-Kinos wieder. In Hamburg, wenn ich mich richtig erinnere, war es das Magazin-Kino in Winterhude, das neben den Filmen der Marx-Brothers (die ebenfalls komplett vergessen waren) Filme von Tati wieder ins Programm hob, und kinoverrückt, wie mein Freundeskreis und ich damals waren, konnten wir uns das nicht entgehen lassen. Und daraus wurde eine lebenslange Liebe.
Tatis Humor ist nicht für jeden das Richtige. Man benötigt eine spezielle Antenne dafür, sonst wird es nichts. Ich kenne Leute, die keineswegs zum Lachen in den Keller gehen und dennoch mit Tati nichts anzufangen wissen.
Im Prinzip hat Tati in seinem Leben nur fünf Kinofilme gemacht. Ihre Charakteristik — neben technischer Perfektion — ist durchweg, dass sie eigentlich keine Handlung haben, sondern perlschnurartig von einer Situation zur nächsten springen. Die Personen erleben keine Entwicklung, die Filme fangen irgendwo an und hören irgendwo auf, wobei ihr Witz meist darauf beruht, dass man sich mit keiner der Figuren identifiziert. Tati versetzt den Zuschauer in die Rolle des neutralen Beobachters. Das ist wie in einem Straßencafé zu sitzen und einfach den Passanten zuzuschauen. Wobei in Tatis Filmen manchmal sogar mehrere Gags gleichzeitig und unabhängig voneinander zu sehen sind. Dass das so ist, bemerkt man in manchen Fällen erst beim zweiten Anschauen.
Die zweite Charakteristik seiner Filme ist die massive Tonbearbeitung. Tati hat oft mehr Zeit in die Nachbearbeitung des Filmtons gesteckt als in die eigentlichen Dreharbeiten; fast kein Geräusch in seinen Filmen ist „echt“, sie alle sind nachsynchronisiert und erzeugen oft erst die eigentliche Komik.
Tatis Weg zum Film war der Sport. Ein Foto zeigt Tatis Vater Georges-Emmanuel Tatischeff beim Tennis. Das renommierte elterliche Bilderrahmengeschäft, das er eigentlich übernehmen sollte, interessierte den jungen Jacques allerdings nur mäßig, ihn faszinierten die Aktionen und Bewegungsabläufe des Tennisspiels. Daraus entwickelte er eine Reihe von gleichermaßen witzigen wie präzis beobachteten Sportpantomimen, die er noch um Box- und Reitsport erweiterte. Sie wiesen Jacques den Weg.

Anstatt also den Bilderrahmenladen weiterzuführen, verließ er das Elternhaus und begab sich auf den sehr steinigen Weg in eine unsichere Karriere. Ihm blieben weder Misserfolge noch (sehr viel später) eine völlige Pleite erspart, kurzfristig landete er sogar mal in der Obdachlosigkeit, doch mit Sportpantomimen auf Varietébühnen und in Music Halls sah er dann wieder Land. Nebenher verkürzte er der besseren Merkbarkeit wegen seinen russischen Namen. Und er entdeckte das Medium Film, das noch so neu war, dass es in alle Richtungen Möglichkeiten bot. Sein erster Kurzfilm erschien 1932 und hieß (konsequent) Oscar, champion de tennis. Der Film ist verschollen. 1936 kam dann Fred Orain ins Spiel (Cady Films), der Tatis Produzent wurde, und mit ihm wurde die Sache professioneller.
Jour de fête (Tatis Schützenfest) von 1949 war mein Erstkontakt mit Tatis Werk (wobei das, was das Magazin-Kino zeigte, wohl die von ihm selbst umgearbeitete Version von 1964 gewesen sein müsste, denn ich erinnere mich an den leitmotivisch durch den Film führenden Maler, der in der Urfassung noch gar nicht vorkam).

Die Zuschauer erwarteten, dass dessen Hauptfigur, der Dorfbriefträger François, nun serienartig in weiteren Filmen auftauchen würde, aber Tati sah klar, dass diese Figur nicht entwicklungsfähig wäre. François konnte nichts anderes sein als eben dies: ein Briefträger, der zufällig auf dem Jahrmarkt einen persiflierenden Film über das amerikanische Postzustellwesen sieht und daraufhin in einen hochkomischen Geschwindigkeitsrausch verfällt, letztlich aber doch bleibt, was er ist: Briefträger. Nur als solchen lernen wir ihn kennen. Weder scheint er ein Zuhause zu haben noch eine Familie.

In den 1970ern ist es Tatis Tochter Sophie gelungen, den Film in seiner Farbfassung zu restaurieren. Er wurde damals in einem Farbsystem gedreht, das sich als nicht funktionsfähig herausstellte; glücklicher- und vorsichtigerweise jedoch hatte Tati parallel auch immer eine Kamera mit Schwarzweißmaterial mitlaufen lassen. Leider enthält die restaurierte Farbfassung einige Eingriffe in den Ton, die nicht sehr geglückt sind. Aber man kann wohl nicht alles haben.
Für seinen nächsten Film entwickelte Tati eine Figur, die als eine Art Projektionsfläche durch das Geschehen führt: Monsieur Hulot, eine Gestalt mit Hütchen, latent Hochwasser signalisierender Hose, gestreiften Socken, Pfeife, Regenmantel und ein eingerollter Regenschirm. Er spricht (in allen seinen Filmen) kein Wort außer „Hulot“, ist manierentechnisch nicht unbedingt vom Feinsten, fährt ein ständig fehlzündendes Auto und lässt keinen Straßenhund ungestreichelt. Er gerät von einer Situation in die nächste, ihm oder durch ihn passieren alle möglichen Dinge, und doch bleibt er selbst dabei als Figur stets neutral, er kommt nirgendwo her und geht nirgendwo hin. Sein Witz beruht meist darauf, dass er langsamer oder schneller als seine Umwelt ist, nur selten aber synchron mit ihr.
Um diese Figur herum gestrickt erschien 1953, produziert wiederum von Fred Orains Cady-Films Le Vacances de Monsieur Hulot (Die Ferien des Monsieur Hulot) — und wurde ein weiterer Welterfolg.

Erstmals entfaltet sich Tatis beobachtende und akustische Komik hier auf ganzer Linie, aber auch Szenen, die deutlich auf seiner pantomimischen Erfahrung basieren, sind enthalten. Gelegentlich gibt es Szenen mit vollem Körpereinsatz, etwa jene, in der Hulot von einem sich spannenden Abschleppseil ins Wasser geschleudert wird, oder bei einem versehentlich ausgelösten Feuerwerk (bei dessen Dreh er sich heftige Verbrennungen zuzog).
Tati hat sich stets nur äußerst ungern in seine Vorstellungen hineinreden lassen. Typisch für ihn allerdings auch: Nur keine Idee umkommen lassen. Tauchten schon in Jour de fête Szenen auf, die aus seinem Kurzfilm L’École des facteurs (Die Schule der Briefträger, 1947) stammen, so lässt er in Les Vacances seine Tennispantomime wieder aufleben. Auch in späteren Filmen griff Tati alte Ideen wieder auf.
Eine andere von Tati heißgeliebte Idee war es, Menschen bei völlig sinnloser Arbeit zu zeigen — man denke etwa an Tatis nächstem Film, Mon Oncle von 1958, in dem immer wieder ein Straßenkehrer dabei gezeigt wird, wie er einen Kehrichthaufen von einer Straßenseite zur anderen fegt und die Arbeit dann im letzten Moment doch unterbricht, weil er dringend mit irgendwem ein Schwätzchen halten muss. Der Film lotet den Widerspruch aus, der sich aus menschlichen Lebensvorstellungen und dem (vorrangig technischen) Fortschritt ergibt. Ins „alte, romantische Paris“ seiner Nachbarschaft ist Hulot hier vollständig integriert, er fremdelt aber heftig mit der modernen Lebensweise der Familie seines Schwagers, den Arpels. Umso mehr liebt ihn deren Sohn Gérard, Hulots Neffe.

Der Job, den Arpel Hulot hier andient, ist ebenso sinnlos wie der pedalbetriebene Rasenmäher einer Nachbarin, der sich trotz gewaltiger Tretanstrengung nur sehr langsam vorwärtsbewegen lässt.

Auch das seltsam verbaute Treppenhaus in dem Haus, in dem Hulot wohnt, passt in diese Richtung, denn es hat keinerlei Logik.

Es ist kennzeichnend für Tatis Komik, dass Monsieur Arpel am Ende des Films Hulot als Vertreter nach Nordafrika schickt, womit Hulot als „Störfaktor“ in der modernen Welt der Arpels nicht mehr vorhanden ist — aber er geht nicht ganz, es bleibt etwas von ihm zurück: Noch am Flughafen verändert sich plötzlich Arpels Verhalten Gérard gegenüber, mit einemmal hat er Spaß daran, mit seinem Sohn einen Streich auszuhecken. Dass der Film das „alte Paris“ und seine skurrilen Bewohner dabei auf verschiedenen Ebenen überromantisiert, mag man Tati nicht übelnehmen. Mon Oncle (My Uncle in der englischen Version) wurde 1959 mit einem Oscar für den besten ausländischen Film ausgezeichnet, und er blieb Tatis größter Erfolg.
Von Fred Orain hat sich Tati danach getrennt und mit der Specta-Film eine eigene Produktionsfirma gegründet, um die volle Autonomie über seine weiteren Projekte zu gewinnen. Doch das sollte ihm heftig auf die Füße fallen.

Playtime, nach fast sieben Jahren Vorbereitungszeit 1967 fertiggestellt, wurde Tatis bester Film, ein Geniestreich und gleichzeitig, wie sich herausstellen sollte, ein Albtraum. Denn Tati war hier nichts zu teuer und nichts zu gründlich ausgetüftelt, um nicht realisiert zu werden; angefangen beim 70-Millimeter-Bildformat, dem Mehrkanalton und der wunderbar-pathetischen Orchestermusik, bis hin zu „Tativille“, einer Hochhauslandschaft, die Tati vor den Toren von Paris errichten ließ. Sie sollte als Kulisse dienen und massiv genug sein, um später tatsächlich an Firmen und Geschäfte vermietet werden zu können (so ließ sie sich nicht verwirklichen, aber auch eine Nummer kleiner war sie immer noch gigantisch).

Eine Handlung im eigentlichen Sinn gibt es auch in Playtime wieder nicht. Auch Monsieur Hulot tritt hier nur noch als Randfigur auf, die auf der Suche nach einem Geschäftspartner inmitten einer großen Zahl von Touristen von einer Situation in die nächste gerät, dabei aber selbst immer seltsam unbeteiligt bleibt. Ton und Beobachtung sind die tragenden Elemente des Films, der „Modernität“ persifliert — das Paris, das man kennt, erscheint nur noch gelegentlich als Spiegelung in Glastüren,

in einem neueröffneten Restaurant gibt die Neoninstallation über dem Eingang ständig ein höchst ungemütliches Geräusch von sich,

das darin enthaltene Symbol, das auch an allen Stühlen angebracht ist, drückt sich bei den Gästen in die Kleidung, und letztlich bleibt der Bodenbelag an den Schuhen der Gäste kleben und die Dekoration bricht zusammen. Ein altgedienter Portier in einem Bürohaus verzweifelt an einer elektronischen Schalttafel,

auf einer Verkaufsveranstaltung werden antikisierende Mülleimer vorgestellt
und schallschluckende Türen demonstriert, die man lautlos zuknallen kann. Legendär eine lange Nacht-Einstellung, in der von außen zwei Familien durchs Fenster beobachtet werden, die, obwohl in zwei verschiedenen Wohnungen lebend, scheinbar aufeinander reagieren.

Und es gibt im Film eine junge amerikanische Touristin (Barbara), der Hulot einen kleinen Strauß Maiglöckchen schenkt. Am Ende des Films sitzt sie in einem Reisebus und betrachtet die am Fenster vorbeihuschenden modernen Straßenlaternen

— und man nimmt sie als Maiglöckchen wahr.

Solche Dinge konnte nur Tati zaubern, niemand sonst.
Playtime wurde ein gigantischer Flop. Es gab kaum Kinos, die den Mehrkanalton präsentieren konnten, die Zuschauer verstanden die handlungslose Komik nicht, und sie vermissten den Monsieur Hulot, den sie kannten und der hier wirklich nur noch eine Nebenrolle spielt.
Tati riss mit Playtime nicht nur sich selbst, sondern mit zum Teil sehr schrägen Methoden auch andere Beteiligte (wie etwa die deutsche Atlas-Film) in die Pleite, aber es half nichts, am Ende musste er sogar das Originalnegativ versteigern, doch selbst das brachte nicht mehr viel.
Ich will hier nicht Tatis ganze Geschichte wiedergeben. Er musste nach diesem Reinfall wieder mit kleinen Brötchen beginnen, aber er gab nicht auf. Sein letzter Kinofilm war Trafic, der nach unendlich langen Verhandlungen und unter zum Teil sehr schwierigen Bedingungen 1971 in die Kinos kam.

Diese Persiflage auf den modernen Autoverkehr ist deutlich stärker auf Bodenhaftung hin produziert, Monsieur Hulot spielt wieder eine tragende Rolle, er hat hier sogar einen Beruf (er ist technischer Zeichner), und am Ende deutet sich sogar so etwas wie eine Romanze an, die allerdings nicht ausgespielt wird.
Ein letztes Mal trat Tati 1974 in dem Film Parade in Erscheinung, einer Produktion des schwedischen Fernsehens — eine Hommage an die Varieté- und Zirkuslandschaft, in der Tati noch einmal seine Sportpantomimen unterbringen konnte. Danach hörte man nichts mehr von ihm; er verstarb 1982 in Paris an einer Lungenembolie. Er hinterließ ein Drehbuch namens Confusion, das nie realisiert wurde.
Wie viele Komiker war auch Tati als Privatperson eher unkomisch, er konnte sogar sehr grob und egoistisch sein. Schon in den 1960ern wurde er als einer der bedeutendsten Komiker der Kinogeschichte angesehen, seine liebevolle Art der Filmkomik war und blieb einzigartig. Und doch gab es lange Zeit mehr Fachliteratur über ihn als Filme von ihm; nur eine relativ knappe Biografie war zu haben („The Films of Jacques Tati“ von Brent Maddock, 1977), die sich aber, wie schon der Titel verrät, eher mit den Filmen als mit seinem Leben befasst.
Eine solche umfassende Biografie hat erst 1999 David Bellos, Romanist an der Princeton University, vorgelegt. Die ist nun, übersetzt von Angelika Arend, endlich auch auf deutsch erschienen:

Alles, was in diesem Post zu lesen ist, kann man in diesem gelegentlich zwar ein wenig steif, gleichwohl aber gut lesbar geschriebenen Buch auf 540 Seiten nachlesen. Ein paar Ergänzungen würde man sich gewünscht haben, auch habe ich den Eindruck, dass Jour de fête im Buch ein wenig überrepräsentiert ist. Bellos hat außerdem in einer Art Anhang die Lebensgeschichte von Helga hinzugefügt — eine Tochter Tatis, die dieser nie anerkannt hat; eine hoch unerfreuliche Story. Aber auch das war Jacques Tati.
David Bellos:
Jacques Tati: Sein Leben und seine Kunst
Aus dem Englischen von Angelika Arend
Mitteldeutscher Verlag, Halle 2025
ISBN 978-3-96311-879-1
Das Buch gibt es auch in englischer und französischer SpracheÜbrigens, vor Jahren gab es mal eine „tativille.fr“ benannte Webpage, die wunderschön war. Leider ist sie verschwunden. Wie so vieles. Schade drum.
Ab 1. September
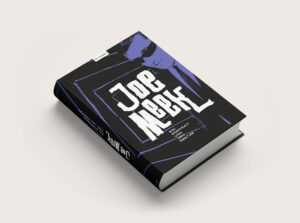
Mal gefeiert als Genie, mal belächelt als Exzentriker: Joe Meek sprengte musikalische Grenzen und schuf in den frühen 1960ern einen Sound, der bis heute nachhallt.
Mit seinem Superhit „Telstar“ brachte er als erster Brite einen Song an die Spitze der US-Charts. Seine Experimentierfreudigkeit und sein Glaube an das Übernatürliche führten zu innovativen Klängen, die ihm Kultstatus einbrachten. Doch hinter dem Erfolg verbarg sich eine tragische Figur: Meek kämpfte mit psychischen Problemen, einer Tablettensucht und dem polizeilichen Schwulenregister. Seine Besessenheit und sein exzessiver Arbeitsstil endeten 1967 in einem tödlichen Drama.
Dies ist die erste Joe-Meek-Biografie in deutscher Sprache. Sie beleuchtet das Leben des Musikproduzenten, dessen Einfluss auf die Popkultur bis heute spürbar ist. Ein Leben zwischen Genialität und Tragik.Ab 1. September überall, wo es Bücher gibt.
Oder schon jetzt hier vorbestellen.Der Hüsch
Am 6. Mai hätte Hanns Dieter Hüsch seinen 100. Geburtstag feiern können. Möglicherweise hat er das ja auch, wer weiß, wo. Als Christenmensch wird er da seine eigenen Vorstellungen gehabt haben, und wie er mehrfach erwähnte, hat er den lieben Gott ja gelegentlich getroffen — mit dem Fahrrad in Dinslaken. Klar, wie sonst.
Ein „Kalenderblatt“ im Deutschlandfunk machte mich auf seinen 100. aufmerksam. Der wäre mir sonst entgangen — seltsam genug, denn dieser Künstler, der mit „Kabarettist“ nur sehr unvollständig beschrieben ist, hat mich durchs Leben begleitet wie sonst wohl nur Kurt Tucholsky, Kraftwerk, Jefferson Airplane und Creedence Clearwater Revival.
Etliche Jazzmusiker der 1960er und 1970er waren politisch denkende Personen und hatten keine Probleme damit, ihre Meinung klar zu äußern. Allerdings blieb diese dann meist eher im kleinen Kreis. Kombinationen aus Kabarett und Jazz waren eine seltene Angelegenheit. Einer machte aber den Schritt, mit Jazzmusikern zu arbeiten, und das war der Kabarettist, Autor, Liedermacher, Radiomoderator und der die Väter der Klamotte zum Leben erweckende Hanns Dieter Hüsch. Er spielte die LP Typisch Hüsch ein; meine erste Platte von ihm.

Mit Jazzern aus der ersten Reihe – Peter Baumeister, Gerd Dudek, Pierre Favre, George Gruntz, Volker Kriegel, Günter Lenz und Eberhard Weber – war dies eine Mischung aus Liedern, gesprochenem Wort, freien musikalischen Kontrapunkten, Gedichten und improvisierter Musik. Philosophische Fragen wechselten sich ab mit Themen wie Vietnam, Kriegsdienstverweigerung, Folter, Fragen an die Väter, das Leben als Minderheit, Alleswisser, die Bedeutung von Solidarität, Kirche, selbst Umweltverschmutzung war bereits ein Thema. Typisch Hüsch ist noch heute ein reinigender Regen für den Kopf.
Die Platte bescherte Hüsch allerdings eine Menge Ärger, und er erlebte das nicht zum ersten Mal – das war in der Tat typisch für ihn. Hüsch war nie jemand, der mit der Masse lief. Viele seiner Kollegen und das (weitgehend studentische) Publikum sahen das Album als „nicht links genug“ an, sie warfen ihm vor, er kratze an den ideologischen Grundfesten der Studentenbewegung, und überhaupt hätte er ein ganz anderes Album machen müssen.
All dies war nichts Neues für Hüsch. Er war seit 1946 Kabarettist, sowohl solo als auch mit einer Gruppe namens „Arche Nova“, und er verfügte über ausreichend Routine, um mit Publikumsreaktionen aller Art umgehen zu können. Im Jahr 1968 auf der Burg Waldeck kam es allerdings deutlich heftiger: Dort wurde er nach nur zwei Songs von der Bühne gebuht. Das Publikum wollte beinharte Agitation, nicht Humor, Ironie und gelegentliche Selbstzweifel: „Ich musste ja dann mein ‚Konzert‘ abbrechen, mich auf ein Stühlchen setzen und Rede und Antwort stehen, und jeder kleine Politkacker wollte von mir wissen, warum ich immer so unterhaltend sei und mein poetisches Vermögen nicht mehr in den Dienst von Fortschritt und Aufklärung stelle, und ich sei ja doch mehr ein spätbürgerlicher Formalist und kein revolutionärer Volkstribun.“ Franz-Josef Degenhardts Lied „Zwischentöne sind bloß Krampf im Klassenkampf“ kam bei diesem Publikum besser an, aber das konnte nie Hüschs Motto sein.
Nach Typisch Hüsch verließ Hüsch das Pläne-Label, seine Familie und Deutschland – einesteils wegen der Angriffe auf ihn, die sich in der Folge auch in anderen Städten fortgesetzt hatten, zum anderen aber auch, weil er sich in die Schweizer Schauspielerin Silvia Jost verliebt hatte. Ein daraus resultierendes gemeinsames Programm der beiden hieß Faux Pas de Deux (1974), aus dem Hüschs traumhaft-verträumtes „Abendlied“ stammt. Er griff dieses Stück auch in späteren Programmen immer wieder einmal auf.
In St. Gallen schrieb Hüsch sein wohl komplexestes, surrealstes, verstörendstes, bitterstes und gleichzeitig poetischstes Bühnenprogramm, Enthauptungen, das nach seiner Uraufführung in Basel im Jahr 1971 als Doppel-LP auf dem Intercord-Label erschien.

Der Titel kann auf die Art und Weise bezogen werden, wie sich Hüsch in Deutschland behandelt fühlte, ebenso aber auch als das abstrakte Gegenteil von Behauptungen – vielleicht steckt ein bisschen Zen darin.
Drei Jahre später kehrte Hüsch nach Mainz zu seiner Frau und seiner Tochter zurück, die ihn wieder aufnahmen. Dass sein Verhalten den beiden gegenüber kein Heldenstück gewesen war, hat er in seiner Autobiografie („Du kommst auch drin vor“, erschienen 1990) und so manchem Text verarbeitet.
Für sein erstes Bühnenprogramm nach der Rückkehr spielte ihm die Hamburger Jazzrockband Altona einige Backings ein. Sie sind auf dem resultierenden Doppelalbum zu hören (Nachtvorstellung, 1975, in nicht sehr geglücktem Kunstkopf-Stereo im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg mitgeschnitten).

Mir ist die Platte schon deshalb nicht egal, weil ich selbst unter den Klatschern im Publikum saß; das erste Mal, dass ich Hüsch live erlebte. Es folgten etliche weitere Male, bis zu seinem letzten Bühnenprogramm „Wir sehen uns wieder“, 1997 in der Hamburger Musikhalle.
Hüsch spielte für den Rest seines Lebens hauptsächlich Soloprogramme, oft an bis zu 250 Abenden im Jahr. Wenn es überhaupt ein Programm gibt, das er als „sein wichtigstes“ ansehen würde, dann dürfte es Das neue Programm von 1981 gewesen sein — „für Frau und Tochter, Freunde und Feinde“, wie der Untertitel lautete.
Unter Stehlampen sitzen wir
Und warten auf das Kopfnicken
Der Katastrophe.— die Schlusszeilen aus dem Eingangslied.

Obwohl er ein durchaus passabler Pianist war, wurde eine kleine Philicorda-Orgel zu seinem Markenzeichen („Mein Bühnenbild“, wie er zu sagen pflegte). Dieses Instrument konnte er nicht nur für Klangakzente und liegende Akkorde einsetzen, es diente ihm auch als Tisch für seine Manuskriptblätter, von denen er seine Texte locker abzulesen pflegte. Am Ende besaß er fünf dieser Orgeln, die strategisch über Deutschland verteilt waren.
Hüschs Platteneinspielungen gingen von Wortplatten ohne Publikum über Livemitschnitte bis hin zu einer von Kai Rautenberg arrangierten Bigband-Platte (Abendlieder; 1976), die es (wie die meisten seiner frühen Platten) leider nie auf eine CD geschafft hat.

Dabei blieb er dem Jazz immer treu, auch die Philicorda-Klangakzente und -Akkorde sind meist alterierte Jazzakkorde. Hüsch konnte in seinen Bühnenprogrammen witzig, verrückt, versponnen, manchmal albern, aber auch philosophisch, satirisch und politisch sein, wobei Politiker mit Namensnennung eine seltene Erscheinung waren („Mein Kabarett ist mir zu schade dafür“). Hüsch hatte einen messerscharfen Blick für die Kleinigkeiten des Alltags, aber nie wurde Brüllkomik daraus. Er besaß Charisma; er erschien auf der Bühne und hatte den Saal. Er konnte die Zuschauer mit erlesenem Quatsch zum Lachen bringen, sie mit einer einzigen Wendung, mit einer einzigen Zeile zu Tränen rühren und sie im nächsten Augenblick wieder auffangen. Der Spiegel schrieb über ihn: „Hüschs Genius, sein Ansehen und Erfolg beim Publikum bestand darin, dass er von Beginn an seinen Texten eine besondere, auf Gefühl bezogene Rhythmik und eine intensive, teils spontane Interaktion gab, also all die Elemente, welche man auch in der Jazzmusik spürt. Er grenzte sich und sein Werk damit schon früh von anderen Kabarettisten ab und konnte diesen eigenen Stil in der Folge weiterentwickeln.“
Musik spielte in und für Hüschs Programmen immer eine wichtige Rolle. Seine Kollegin Magdalena Thora (heute unter dem Namen Leni Stern als Jazzgitarristin unterwegs) aus der TV-Serie „Goldener Sonntag“ (wenn die lief, durfte mich niemand anrufen) gab ihm eines schönen Tages den Tipp, sich einmal die Musik Steve Reichs anzuhören. Die faszinierte ihn dann derartig, dass er Reichs Musikstrukturen buchstäblich zu komplexen Minimal-Texten verarbeitete, die eine ähnliche Wirkung wie die Musik hatten; besonders deutlich etwa in „Hagenbuch und seine Freunde“ von 1981. Der erste dieser „Hagenbuch“-Texte war entstanden, während im Hintergrund Steve Reichs „Six Pianos“ lief, und irgendwie übertrug sich der Aufbau dieses Stücks auf den Text. Für die ohne Publikum im Studio eingespielte LP Hagenbuch hat jetzt zugegeben (1978) gab er Konstantin Wecker den Auftrag, sieben Reich nachempfundene Klaviermusiken zu schreiben, die als Brücke zwischen den Geschichten dienen.

Zwischen 1979 und 1983 ging Hüsch mit „Hagenbuch“ und der Lars Reichow Bigband auch auf Tournee. „Insoweit Hüsch Kabarettist ist, mag es nicht überraschen, dass er auch mit der Musik operiert, ohne die Kabarett ja nicht denkbar ist. … Aber was noch interessanter ist: Er geht über die bekannten Formen hinaus, erweitert sie, sprengt sie bis in die Bereiche des Experiments mit Klängen der Moderne und Techniken der Collage“, schreibt der Konzertbeobachter Gerd Lisken über diese Auftritte.
In den heutigen Kabarettsendungen im Fernsehen wird man Beiträge wie die von Hüsch nicht mehr finden. In den Siebzigern gab es eine Reihe wie die „ZDF-Matinee“, in der am Sonntagvormittag manchmal recht bemerkenswerte Dinge gesendet wurden, die heute unvorstellbar wären, etwa einen vollen Auftritt von John McLaughlins Mahavishnu Orchestra. 1978 sendete das ZDF in dieser Reihe live aus der Mainzer Universität Hüschs sehr abstrakte Collage Und das Herz schlägt wie ein blinder Passagier. Ich sah es zu Hause. Was wir Zuschauer natürlich nicht wissen konnten: Während der Pause erhielt die Uni einen Anruf aus dem Krankenhaus, dass Hüschs Frau Marianne verstorben war. Alle hinter der Bühne waren zunächst ratlos, ob man ihm das mitteilen sollte. Man kam schließlich überein, dass man das nicht verheimlichen könne, er würde es sonst ohnehin merken. Hüsch, angesichts der Live-Situation, zog den zweiten Teil des Programms durch. — Freunde, die Welt hat kein Dach über dem Kopf (auch das ein Satz aus einem seiner Programme).

Den Lungenkrebs hatte Hüsch gerade überstanden, da erwischte ihn im November 2001 ein Schlaganfall, von dem er sich nicht mehr erholte. Hanns Dieter Hüsch, „der Mann, der den Jazz in Worte fasste“, verstarb im Jahr 2005.
Beim Herumgooglen nach der obenerwähnten „Kalenderblatt“-Sendung übrigens stieß ich auf ein Buch:

Herausgegeben von Malte Leyhausen versammelt der Band rund fünfzig Erinnerungen von prominenten und weniger prominenten Mitmenschen an Hanns Dieter Hüsch, unter anderem von Lioba Albus, Jürgen Becker, Henryk M. Broder, Matthias Brodowy, Katja Ebstein, Okko Herlyn, Franz Hohler, Margot Käßmann, Jürgen Kessler, Renate Künast, Manfred Lütz, Jochen Malmsheimer, Harald Martenstein, Manfred Maurenbrecher, Arnulf Rating, Lars Reichow, Mathias Richling, Nikolaus Schneider, Georg Schwikart, Kai Magnus Sting und vielen anderen. Viele dieser Texte sind lesenswert, auch wenn mir das Buch im letzten Viertel ein wenig zu evangelisch wird. Aber auch das war Hanns Dieter Hüsch. Und wenn der Jubilar den lieben Gott schon in Dinslaken getroffen hat, dann kann man das wohl hinnehmen.
Malte Leyhausen (Hg.):
Hanns Dieter Hüsch zum 100. Geburtstag
Erinnerungen von Freunden und Bewunderern
Mit Illustrationen von Jürgen Pankarz
Hamburg 2025, ISBN 978-3-7693-2783-0
274 SeitenHüschs Platz ist verwaist und wird es wohl bleiben. Und mein Lieblingszitat von ihm ist und bleibt:
Wenn man bedenkt, dass das Ganze nichts auf sich hat.
*
Jonas Engelmann: Gesellschaftstanz

Sein Interesse gilt den Außenseitern des Musikgeschäfts. Denen widmet sich Jonas Engelmann mit viel Kenntnis und Sympathie. Dabei geht es ihm nie nur um Musik, sondern immer auch um ihre Einordnung in soziale, politische und wirtschaftliche Hintergründe.
Ein Beispiel gefällig? Ich habe bislang immer geglaubt, in einem Musikstück ein Sample einer anderen Platte unterzubringen, sei eine Art Statement: Das Sample soll wiedererkannt werden und dient so dazu, dass der Künstler X seine Verehrung für den Künstler Y zum Ausdruck bringt, oder — die spannendere Variante — sich ein Statement Ys zu eigen macht, im Sinne von: Ich, X, teile das, wofür Y steht.
So war das wohl auch mal. Aber wussten Sie, dass Sampling mittlerweile zu einem blühenden Geschäftszweig geworden ist? Dass es sich für Plattenfirmen mittlerweile lohnt, Leute speziell fürs „Clearing“ von Samples zu beschäftigen, um ihren Einsatz rechtlich und kaufmännisch korrekt abzuwickeln? Dass für ein Sample berühmter Künstler, etwa James Brown, Marvin Gaye, Otis Redding oder auch Barry White (richtig, dem „Walrus of Love“) fünf- bis sechsstellige Dollarbeträge über den Tisch gereicht werden?
So krass war mir das nicht bekannt. Mir scheint mit dem Sample-Handel inzwischen eine Form der Zweitauswertung entstanden zu sein, die oft schon mehr Umsatz generieren dürfte als der Verkauf der ursprünglichen Platte (wobei das Sampling natürlich auch zur Vermarktung des Originals beiträgt).
Was tut sich da für ein merkwürdiger Widerspruch auf zwischen einerseits einem sozialen oder politischen Anliegen der Künstler und andererseits ungebremstem Kapitalismus? Oder ist es gar kein Widerspruch? Man schätzt da vieles falsch ein. Denn war nicht der ungebremste Kapitalismus schon immer Teil der Szene? Sollte jemand gedacht haben, ein Grandmaster Flash sei mal aus irgendeinem armen New Yorker Schwarzenghetto hervorgegangen, so entspricht das sicherlich dem damals in den Medien vermittelten Image. Weiß man jedoch, dass der Grandmaster schon früh über einen Fairlight verfügte, stellt sich seine soziale Situation doch ein wenig anders dar. Offenkundig gab es einen Riss zwischen dem projizierten Image und der Wirklichkeit. Und was ist heute von gerappten Anklagen, Empörungstexten und der damit angestrebten Street Credibility zu halten, wenn der Rapper (oder sein Produzent) in der Lage ist, Summen wie die obengenannten für ein simples Sample zu zahlen? — Ein interessanter Aspekt übrigens auch im Hinblick auf aktuellste Entwicklungen der Black Music.
Die weltanschauliche Theorie ist offenkundig das eine, aber wichtig ist aufm Platz. Da sind wir mitten drin in Jonas Engelmanns Themen und Thesen. Seine Positionen sind eindeutig, nicht immer leicht zu schlucken, aber meist wohlbegründet. Er untersucht Felder wie Außenseiter-Jazz (Sun Ra Arkestra, Matana Roberts, June Tyson), HipHop, Avantgarde (John Zorn, Public Enemy u.a.), die politischen Lieder eines Woody Guthrie, ein Konzert (oder sollte man sagen: das Konzert) von Aretha Franklin.
Alles dies nimmt Engelmann als kulturelle Statements ernst. Er schreibt, wie der Untertitel des Buches verrät, über Klangverhältnisse und Außenseiter-Sounds. Auf 130 Seiten bietet das Bändchen eine Sammlung von insgesamt 19 Artikeln, die zwischen 2012 und 2024 erstveröffentlicht wurden. Ein Blick ins Verzeichnis ihrer Herkunft lässt Rückschlüsse auf ihre Perspektive zu: Neues Deutschland, Jungle World, Freitag, taz, Ventil-Verlag (dessen Co-Verleger Engelmann ist), außerdem ist er Mitherausgeber der testcard-Buchreihe.
Jonas Engelmann geht an die musikalischen Wurzeln, er benennt gesellschaftliche Entstehungshintergründe, er spricht über Rassismus, Queerfeindlichkeit, Praktiken der Musikindustrie, er checkt die Quellen musikalischer Phänomene. Sein Buch ist voller Anregungen, denen nachzugehen sich lohnt (man staunt manchmal, was man im Web mittlerweile alles finden kann, wenn man einmal über die einfache Googlesuche hinausgeht). Und weil er zu argumentieren versteht, macht es Spaß, sich mit seinen Schlüssen auseinanderzusetzen, auch wenn man nicht jeden einzelnen unterschreiben möchte.
Jonas Engelmann:
Gesellschaftstanz — Klangverhältnisse und Außenseiter-Sounds
Verlag Andreas Reiffer, edition kopfkiosk Bd. 12
Meine 2025
ISBN 978-3-910335-12-7Re-viewed
(In English here)
Es ist ein eigenartiges Erlebnis, alte DVD-Boxen wiederzuentdecken: Rote Erde war 1983 ein Prestigeprojekt der ARD. Damals war ich von dieser Serie schwer begeistert. Gelingt ihr das auch noch heute, nach mehr als 40 Jahren?

Die Bergarbeiter-Saga aus dem Ruhrgebiet, wie sie im Untertitel hieß, besteht aus zwei Staffeln. Zeitlich umfasst die Staffel 1 (hergestellt 1983) den Zeitraum von 1887 bis 1919, Staffel 2 (hergestellt 1990) schließt direkt daran an, von 1920 bis zu den ersten Zechenschließungen 1949.
Ein genauer Spielort wird nie genannt, aber der Titel ist natürlich eindeutig. Die Serie ist irgendwo im Westfälischen anzusiedeln, zwischen Niederrhein und Weser. Dabei hat der Begriff „rote Erde“ weder mit Klassenkampf noch, wie man vielleicht vermuten könnte, mit blutgetränkten Schlachtfeldern zu tun, sondern leitet sich wohl von „gerodeter Erde“ ab. Dass man den Titel auch mit der Arbeiterbewegung des Ruhrgebietes in Verbindung bringen kann, liegt allerdings nahe und spielt in der Serie keine geringe Rolle.
Der Set war jedoch anderswo, nämlich auf dem Bavaria-Ateliergelände in München-Geiselgasteig. Dort hat man liebevoll eine Bergarbeitersiedlung nachgebaut — Häuser, Straßen, Wohnungen, Dachböden mit Taubenschlägen, und auch die Schachtanlage selbst, letztere zu ebener Erde. Damals fiel es mir nicht auf, heute beim zweiten Sehen scheint es mir aber doch, dass es immer dieselben drei Stollen sind, die man sieht. Die wurden allerdings mit Hilfe des Lichts und aller möglichen Kameraperspektiven ziemlich gekonnt ausgereizt.
Die erste Staffel lief damals konkurrenzfrei; es gab noch kein kommerzielles Fernsehen und keine Streamingdienste in Deutschland, Binge-Watching war noch kein Thema.

Rote Erde II folgte dann 1990, da musste die Serie bereits gegen etablierte Kommerzsender anfunken. Das merkte man nicht nur optisch, schon die Formate unterschieden sich: Während die erste Staffel in 9 x 60 Minuten präsentiert wurde, kam die zweite in vier spielfilmlangen Teilen. Die sieben Jahre zwischen den Drehdaten und die kommerzielle Konkurrenz machten sich bemerkbar; die Filmsprache der zweiten Staffel war knapper und schneller.
Aber auch das fällt auf: Geschrieben wurde das Ganze noch nicht von der Belegschaft eines „writer’s rooms“, sondern von dem versierten Hörspiel- und Drehbuchautor Peter Stripp (mit fachkundiger Beratung u.a. durch das Bochumer Bergbaumuseum), inszeniert hat die Rote Erde der TV- und Theaterregisseur Klaus Emmerich. Beide, Autor und Regisseur, waren damals schon länger im Geschäft. Nichts gegen die Idee des writer’s rooms, aber es ist ein Unterschied, ob (wie heute üblich) ein Headautor für die Produktion einer Serie etliche Storyliner einsetzt, die dann Dialoge etc. ausarbeiten (ich war selbst mal so einer), oder ob die Drehbücher von Anfang bis Ende in der Hand eines Autors liegen: Da merkt man deutlich dessen individuelle Handschrift. Für eine Serie wie diese scheint mir die dadurch gewährleistete stilistische Einheitlichkeit klar die bessere Lösung zu sein.
Es spielten prominente Namen: Ralf Richter, Dominic Raacke, Sunnyi Melles, Walter Renneisen, Klaus Wennemann, Jörg Hube, Klaus J. Behrendt, Dominique Horwitz, Nina Petri, der wunderbare alte Rudolf Schündler — das allein waren schon Empfehlungen. Und man sah eine interessante Neuentdeckung: Claude-Oliver Rudolph. Seltsam: Ich erinnerte noch, dass er mitspielte, hätte aber nicht mehr gewusst, dass er tatsächlich sogar die Hauptrolle spielte: den 17-jährigen polnischen Bauern Bruno Kruska. Von Werbern ins Ruhrgebiet gelockt will er auf der Zeche Siegfried anlegen, ohne eine Vorstellung davon zu haben, was das eigentlich heißt: Bergwerk. Bruno ist eine undurchschaubare Figur, aber er hat seine Grundsätze. Er lebt sich schnell ein, und ebenso schnell wird deutlich, dass er sich auch gegen Widerstand von niemandem vereinnahmen lassen will. Eine sehenswerte Kombination von Eigenschaften. Man lebt und altert vom Beginn der Serie bis zu seinem Tod in der zweiten Staffel mit Bruno mit; er ist Sympathieträger und gleichzeitig ein Typ, mit dem man sich nicht anlegen möchte. In einer bestimmten Situation lässt er sich sogar dazu hinreißen, aus einem Rachemotiv heraus einen Steiger in einen Blindschacht stürzen zu lassen, aus dem sich dieser nicht mehr befreien kann. Konsequenzen hat dieser Mord für Bruno nicht. — Der Regisseur Dieter Wedel besetzte Rudolph später mehrfach mit brandgefährlichen Schlägertypen, was einerseits authentisch wirkt, aber auch seine schauspielerische Bandbreite eingrenzt.
Und nicht nur mit Bruno Kruska geht es einem so: Man möchte die Protagonisten sympathisch finden, man folgt ihren oft krummen Lebenswegen und Schicksalen, und dennoch bleiben sie merkwürdig fern; man ist gespannt, was sie als nächstes tun, und doch: Man bleibt letztlich doch eher unbeteiligt.
Die Erzählweise der Serie würden wir heute als „horizontal“ bezeichnen, damals gab es diesen Begriff noch nicht. Die Folgen bauen aufeinander auf, ihre Reihenfolge ist zwingend. So verhindern die Kumpel etwa am Ende der ersten Staffel die Sprengung des Förderturms, indem sie das Werk besetzen und sich sogar den aufmarschierenden Soldaten entgegenstellen. Am Ende der zweiten Staffel, im Jahr 1949, wird er dann doch in die Luft gejagt: Sein Einsturz wird den Protagonisten geradezu wie die ungewisse Zukunft selbst vor die Füße geknallt.
Bemerkenswert ist auch der Dreh, die Nazizeit (an der die Serie natürlich nicht vorbeikommt) nicht als Abstraktum aufarbeiten zu wollen oder einfach nur die üblichen Flaggen wehen oder Naziuniformen durchs Bild laufen zu lassen. Stattdessen wird hier ein Ereignis unmittelbar an eine Person geknüpft: Brunos Sohn Max, der zunächst mit den Nazis sympathisiert, erlebt mit, wie ein wohl etwa 12-jähriger Junge ein Brot klaut, dabei von einem allen bekannten SS-Mann erwischt und vor versammelter Pütt-Belegschaft gehängt wird. Alle stehen da, alle sehen zu, auch Max. Etliche ballen die Fäuste, alle könnten eingreifen, keiner tut es. Dieses Erlebnis lässt Max nicht wieder los und bringt ihn am Ende zu einem Schuldeingeständnis, das ich hier nicht verraten will, das aber noch lange nachhallt.
Unterschiede zwischen damals und heute? Unser Sehverhalten hat sich verändert, und das hat Rückwirkungen auf die Filmgestaltung. Einiges, das mir damals, Anfang der 1980er, nicht mal aufgefallen ist, macht sich beim heutigen Wiederanschauen deutlich bemerkbar: Rote Erde hat erhebliche Längen, manche Szenen wurden endlos ausgewalzt, obwohl man längst begriffen hat, worum es geht. Geburten werden ebenso wie Vergewaltigungen in epischer Breite gezeigt. Viele Charaktere sind, wie schon erwähnt, arg holzschnittartig und müssen mit zwei Eigenschaften und ebensovielen Gesichtsausdrücken auskommen. Vor allem aber wird ständig gebrüllt. Das scheint eine Marotte deutscher Schauspieler und Regisseure seit je zu sein; schon Kurt Tucholsky in den 1920ern hat sich darüber amüsiert, dass deutsche Schauspieler ständig schreien. Auch in Rote Erde wird zu oft Hysterie als Stilprinzip eingesetzt, wird Aufgeregtheit mit Spannung verwechselt. Ebenso nervt es nach einer Weile, dass jeder Kneipenabend in einem sinnlosen Besäufnis mit anschließender Schlägerei endet. Natürlich sollen und müssen in einer Serie wie dieser das Elend der Arbeiter, die soziale Ungerechtigkeit, ihre erzwungene Bildungsferne, ihre meist elende Wohnsituation, die auf Befehl und Gehorsam beruhende Arbeitswelt gezeigt werden — aber muss man sie wirklich noch zusätzlich vergröbern, indem man die Farbgebung der gesamten Serie grau, bräunlich und trübsinnig gestaltet? Und weil das noch nicht reicht, muss es immer wieder in Strömen regnen.
Dass im übrigen die gesamte Serie ziemlich linksgedreht ist, wird schnell offensichtlich — typisch dafür ist die fast karikierende Darstellung des von Dominique Raacke gespielten Sozialdemokraten Karl Boetzkes — ein politisch im Wind schwankendes Fähnchen, keinem Kompromiss abgeneigt. Er wird von Autor und Regisseur bereits als Figur nicht ernstgenommen, während die Bergleute in ihrer politischen Ausrichtung stets ideologisch gefestigt zu sein scheinen. Es ist diese unhinterfragte Selbstverständlichkeit, die hier stört; heute würde man das nicht mehr so machen. Differenziertere Charaktere, wie etwa der Reviersteiger und spätere Stahlwerksbesitzer Rewandowski, sind selten, und auch er bleibt ein merkwürdig einseitiger Typ, der stets latent negativ dargestellt wird, obwohl er — wie sich bei einem Grubenbrand zeigt — sofort weiß, wo sein Platz ist: an der Spitze des ersten Rettungstrupps nämlich. Er ist kein angenehmer Typ, aber er bleibt seinen Überzeugungen treu, und als er merkt, dass seine Überzeugungen nicht mehr gefragt sind, zieht er die klassische Konsequenz. Auch der von den Arbeitern respektierte Kaplan (von Jörg Hube gespielt) wird irgendwann einfach versetzt und taucht dann nur noch einmal wieder kurz auf, ohne dass wir je den Grund für seine Versetzung erfahren. Da wäre mehr drin gewesen.
Über die historische Wahrheit all dieser Darstellungen kann man ohnehin streiten, Rote Erde ist keine Dokumentation und will auch keine sein. Die linke Perspektive der Serie jedenfalls galt damals als progressiv und war bei Produktionen des deutschen Buntfernsehens normal. Damals ist mir das nicht wirklich aufgefallen, heute schon. Wobei, damit das klar ist, gegen Parteinahme und Sympathie nichts einzuwenden ist, aber es wäre sicher auch ein wenig weniger aufdringlich gegangen.
Rote Erde war in gewisser Weise ein Vorläufer von Edgar Reitz‘ Meisterwerk, der Heimat-Trilogie, deren erste Staffel im Jahr 1984 ins Fernsehen kam.

Beide Projekte haben nicht voneinander abgekupfert; das konnten sie nicht, da sie zum Teil zeitgleich gedreht wurden. Der Vergleich beider Projekte (Heimat hat sich nicht als „Serie“ bezeichnet und ist auch keine) ist dennoch naheliegend und erhellend, denn er zeigt deutlich, wie unterschiedlich die Herangehensweisen waren. Während Stripp/Emmerich sehr auf ein „allgemeines Bild“ setzen, auf Atmosphären, die auf der gesamten Serie liegen (um nicht zu sagen: lasten), baut Reitz (der Regisseur und Drehbuchautor war) in seiner Heimat von Anfang an viel stärker auf die Charaktere. Längen gibt es auch in Heimat, aber Reitz hat einen anderen Blick als Emmerich. Und obwohl auch hier die Weltkriege und die Nazizeit nicht ausgelassen werden, gibt es kaum Klischees, keine „Typen“, fast alle Figuren sind individuell gedacht, haben ihren eigenen Kopf und eigene Lebensvorstellungen. Auch, wenn man diese nicht unbedingt immer teilt, entstehen doch Wege, Irrwege und sehr lebendige Beziehungen, mit denen man unmittelbar mitfühlt und mitlebt — ein Effekt, der in Rote Erde praktisch nicht zustandekommt.
Kein kommerzieller Sender würde Serien wie diese beiden je auch nur ins Auge gefasst haben, auch Netflix wohl nicht, obwohl dessen Serienangebot ja zeitweilig ein Ruf wie Donnerhall vorauseilte. (Heute wird man sagen dürfen, dass auch bei Netflix nur mit Wasser gekocht wurde, und inzwischen hat man schon manchmal das Gefühl, dass auch das mittlerweile bereits verdünnt wird.) In den 1980ern waren Projekte wie diese noch möglich. Aber schon die dritte Heimat-Staffel wurde von der ARD regelrecht verhunzt, weil die Verantwortlichen es wichtiger fanden, sie für das Programmschema passend zu machen, statt ihr den Raum zu geben, den sie braucht. So kam es zu dem Effekt, dass nur die DVD-Version die Intentionen des Regisseurs wiedergab, die TV-Ausstrahlung wurde zum Flop. Und das war leider irgendwie sehr typisch.

Zu guter Letzt: Was mich 1983 vor den Fernseher gelockt hat, in die Rote Erde hineinzuschauen, das war gar nicht der Film, sondern zunächst mal die Musik. Die nämlich war, so hatte ich gelesen, von Irmin Schmidt (den Lesern dieses Blogs muss ich sicher nicht erklären, wer das ist). Es war diese wunderbar melancholische Titelmusik, die mich sofort erwischt und zum Dranbleiben animiert hat. Sie hat nichts von ihrem Reiz eingebüßt.
Irmin Schmidt, behaupte ich mal, gehört zu den besten Filmkomponisten im deutschen Sprachraum; er arbeitete auch vor dieser Serie bereits an anderen Serien mit Klaus Emmerich zusammen. (Einen Kommentar von Emmerich findet man in dem Buch „All Gates Open — The Story of Can“ von Rob Young auf Seite 531.) Mit seiner Filmmusikarbeit hielt Schmidt nicht zuletzt auch seine Gruppe CAN über Wasser. An seiner Musik zu den Rote-Erde-Staffeln wirkten damals klingende Namen wie Michael Karoli, John Marshall, Max Lässer, Gerd Dudek, David Johnson und Manfred Schoof mit; es gab den Soundtrack damals, in der Prä-CD-Ära, als LP. Zum Glück habe ich die noch; der Score ist später weder als CD noch in den Streamingdiensten vollständig wiederveröffentlicht worden; lediglich Schmidts erste Filmmusik-Anthologie enthält ein paar Titel. Was sehr schade ist, denn einige der Musiken gehen auch ohne die dazugehörigen Bilder unter die Haut — etwa die „Trauermusik“ aus der ersten Staffel, oder „Es geht ein Schnitter“ aus der zweiten: Michael Karoli überlagert in letzterem ein sehr moll-lastiges E-Piano- und Geigenmotiv mit einer langen Gitarrenrückkopplung, die einem buchstäblich die Seele zerschneidet. Dabei gehört schon die Titelmusik zu jener Sorte von Musiken, mit denen man morgens aufwacht, ohne zu wissen, wo sie herkommt. Schmidt findet in seinen Musiken eine perfekte Balance zwischen dem zur fiktionalen Zeit des Films vorhandenen einfachen Instrumentarium und moderner heutiger Elektronik und Verfremdungseffekten. So wird die Musik glaubwürdig, ohne in falsche Volkstümlichkeit zu fallen.
Um die Eingangsfrage zu beantworten, ob es sich lohnt, sich die Serie heute noch anzuschauen: Ja, eindeutig ja, trotz aller Einwände und Relativierungen. Man muss übrigens die DVD-Boxen gar nicht kaufen — alle Rote-Erde-Folgen stehen hier auf Youtube.
Hans Ulrich Obrist: A Brief History of New Music

Hans Ulrich Obrist is a Swiss critic and curator, since 2026 at Serpentine Gallery, London. His first contact to the world of arts happened when he visited Swiss artists Fischli & Weiss at their studio when they were busy with their now famous video Der Lauf der Dinge. Later he met Gerhard Richter in his studio and traveled through Europe from interview to interview for around six years, in 1993 he started the arts association „museum in progress“. Since then there was probably no artist of relevance he didn’t talk to. Composers and musicians have always been part of it. He recorded nearly 2000 hours of interviews; he called this project „an endless conversation“.
This book, A Brief History of New Music from 2015, contains a sort of „best of“ from those interviews. Partitioned into sections „Avant-Garde Composers“, „The Birth of Electroacoustic Music“, „Minimalism & Fluxus“ and „Modern Masters“ there are 17 interviews, among them Karlheinz Stockhausen, Pierre Boulez, Iannis Xenakis, Robert Ashley, Pauline Oliveros, Terry Riley, Steve Reich, Yoko Ono, Brian Eno, Ralf Hütter and Caetano Veloso. Every single one of these interviews is carefully prepared; Obrist knows what the interviewees did, he knows about their background, and he knows what to ask them. But he also knows when it’s better to let them talk, which sometimes can lead to highly interesting statements nobody could have planned before.
Some of the interviews — especially the ones with Stockhausen and Reich — are extremely interesting and concentrated (I used a lot of the Stockhausen interview here), Brian Eno has some interesting things to say about songwriting, Steve Reich’s tape compositions and their influence on his own Music for Airports, some other interviews are a little bit so-so, sometimes — like with Arto Lindsey — one gets the impression that this guy is in a bad mood or not willing to talk much. Kraftwerk’s Ralf Hütter says exactly what he wants to say and not a syllable more, in the end he comes up for the umpteenth time with his fairytale of 168 weekly working hours at their studio. (But to be fair: What he’s talking about is in fact the phenomenon that a creative artist has always something going around in his head about projects, may it be in the foreground, may it be on the second track, but it never stops, it’s always there.) And as Obrist knows this phenomenon, his most-asked question is: „What project are you working on currently, and are there any projects you would like to do and couldn’t realize yet?“ The answers to this question are usually the most interesting ones.
Of course the interviews are edited, but anyways, reading „spoken word“ can sometimes be a bit stressful. But it’s worth the effort. My only complaint: The introductions to the interviews are printed in a nearly unreadable small face. As there is no lack of space, this is simply annoying.
Hans Ulrich Obrist:
A Brief History of New Music
JRP/Ringier Kunstverlag, Zürich 2015
ISBN 978-3-03764-190-3
Book in English language, 300 pagesKlaus Schulze: Bon Voyage
(In English: here)
Dass uns Klaus Schulze verlassen hat, ist nun auch schon wieder drei Jahre her. Auf Neuerscheinungen mussten die Fans dennoch nicht lange warten, und produktiv, wie er war, ist anzunehmen, dass noch manches folgen wird.
Ich meine mich zu erinnern, Schulze dreimal live gesehen zu haben: Erstmals 1977 im Hamburger Audimax, damals noch mit dem Big Moog auf der Bühne, gerade stand sein Jubiläumsalbum X. vor der Tür, für das überall im Audimax kleine Werbeaufkleber herumflogen. Ich erinnere das Konzert als atmosphärisch stark. Das zweite Mal war 1981 ebenda, mit dem Gitarristen Manuel Göttsching und erstmals mit dem damals neuen GDS-Computer. Und dann war da noch ein drittes Konzert, diesmal in der Fabrik mit einem Fairlight und dem Gast Rainer Bloss, der inzwischen den GDS übernommen hatte; es müsste wohl 1985 gewesen sein. Mir in Erinnerung vor allem wegen des Vorhangs, der sich mehrere Minuten lang nicht öffnen wollte. Relativ aktuell war da noch das Live-Album Dziekuje Poland, eingespielt von eben diesem Duo.
Mit Deus Arrakis hatte Klaus Schulze ein verdammt starkes letztes Album hinterlassen, danach veröffentlichten seine Erben noch die Filmmusik 101, Milky Way aus dem mir nicht bekannten Film „Hacker“. Nun haben die Erben erneut ins Archiv gegriffen und den Mitschnitt des Audimax-Konzertes von 1981 ausgegraben: Bon Voyage heißt das gute Stück, zwei CDs und eine DVD.

Ich habe damals nicht mal bemerkt, dass das Konzert gefilmt wurde, und tatsächlich war das Video eigentlich nur dazu gedacht, den beiden Musikern einen Eindruck zu vermitteln, wie sie auf der Bühne aussahen. So muss man die DVD denn wohl auch sehen: als eine Erinnerung an den Auftritt, qualitativ ist es weder technisch noch in der Bildführung besonders gelungen. Auch der Ton ist eher mäßig, aber das macht nichts, denn dafür sind ja die CDs (bzw. die Doppel-LP) da, und an deren Qualität gibt es nichts zu bemängeln. Dazu gibt es ein gut gemachtes Booklet mit bis dahin unveröffentlichten Fotos und Liner Notes von Claus Cordes in deutsch und englisch. Wer das alles nicht braucht: Den Ton gibt es auch bereits auf den üblichen Streamingdiensten.
Es ist ein bisschen dreist, dass nur Klaus Schulze auf dem Cover genannt wird, denn tatsächlich stand die gesamte Zeit hindurch auch Manuel Göttsching mit seiner Gitarre auf der Bühne. Dass er ein exzellenter Gitarrist war, muss nicht extra betont werden. Leider nutzt er das Instrument fast ausschließlich zum Ansteuern eines Gitarren-Synthesizers. Diese Geräte waren damals noch sehr schwer zu bändigen; mir fallen auch nur zwei Gitarristen ein, die das wirklich draufhatten: Steve Hillage und Pat Metheny, und irgendwie kommt mir Manuel hier ein bisschen in den Hintergrund gemischt vor — mehr, als er es eigentlich verdient gehabt hätte.
Klaus Schulze war nie ein großer Tastendompteur, das zeigt sich nicht zuletzt im Video sehr deutlich. Sein Talent bestand vielmehr darin, sich sehr effektiv die Technik zunutze zu machen, um einen eigenen, unverwechselbaren Stil zu entwickeln. Den hatte er schon recht früh ziemlich exklusiv, und er wich davon auch kaum je ab.
Musikalisch fiel das hier vorliegende Konzert in die Zeit der Alben Dig It und Trancefer. Das war die Zeit, in der Schulze vom analogen zum digitalen Equipment wechselte, und das ist unüberhörbar. Der GDS-Computer der italienischen Firma Crumar beherrscht die Szene. Ein großer Erfolg war dieser Kiste nicht beschieden; meines Wissens sind nicht mehr als zehn dieser Geräte gebaut worden (andere Besitzer waren Wendy Carlos und Chris Franke). Statt der bis dahin gewohnten warmen Analogklänge hörte man nun kühle Digitalsounds. Das war gewöhnungsbedürftig, und es ist offensichtlich, dass Schulze den Computer noch nicht wirklich auszureizen verstand. Das ganze Konzert bewegt sich in durchgehend hohem Tempo, und immer wieder grüßen die beiden obengenannten Alben durch, streckenweise, wenn mich nicht alles täuscht, sogar inklusive der von Michael Shrieve für Trancefer eingespielten Percussion, die hier als Sample mitläuft. Tatsächlich ist Trancefer für mein Gefühl eines von Schulzes besten Werken, aber so richtig überträgt sich dessen Stimmung nicht auf die Bühne.
Anyway, wer Klaus Schulze nie live gesehen hat, kann das hier nachholen. Das ganze Set kostet gerade mal 16 Dollar, da kann man wirklich nicht viel falsch machen.

Es genügen …
die ersten vier oder fünf Noten, und man weiß mit geschlossenen Augen, wer das ist. Diese Melodieführung hat sie exklusiv. Ich bin neugierig auf das bevorstehende Album.
Das fidele Grab an der Donau
So hat der Schriftsteller Alfred Polgar sein Wien beschrieben. Dieser Satz hat viele Dimensionen. Nicht zuletzt ist er der Titel eines Buches von Georg Stefan Troller, im Untertitel „Mein Wien 1918 – 1938“.

Der Filmemacher, geboren 1921, nimmt uns in diesem Buch mit auf eine Reise durch die Zeit zwischen den Weltkriegen, dokumentiert sie in Zeitzeugenaussagen, Zeitungsartikeln, Filmen, Kabarett, und nicht zuletzt durch seine eigenen Erinnerungen — mit seinen damals schon um die 80 Jahren hat er reichlich davon (heute ist er 103!). Und sie sind keineswegs nur romantisch, sondern Resultat scharfer Beobachtung und eines bisweilen harten, polemischen Humors, wie man es auch aus seinen Filme kennt. Anders wäre die Geschichte auch nur schwer zu ertragen.
Dieses Buch ist bereits 2004 erschienen. Ich, alter Wien-Fan, habe es damals gekauft und irgendwie im Regal vergessen. Jetzt habe ich es wiederentdeckt — was für eine Entdeckung!
Und wie verdammt aktuell sie ist.
Das alte Café Central ist der Ausgangspunkt. Das „alte“, das „klassische“ Wien, das Wien der Caféhäuser, das Wien der Zwischenkriegszeit, der zerfallenden Restbestände der K.u.k.-Monarchie, um sie geht es. Man liest, wie Wien versuchte, nach dem Ersten Weltkrieg so etwas wie eine neue Identität aufzubauen, die dann aber in Jahre des Verschweigens und Verfälschens mündete. Es geht um die Vergeblichkeit solcher Bemühungen, um die an sich selbst verzweifelnde (gelegentlich auch selbstmitleidige) Kulturszene jener Jahre. Denn in Wirklichkeit war natürlich nichts so, wie es zu sein schien, und alle Bemühungen führten — nun ja, man weiß, wohin sie führten. Der Autor erspart uns das nicht.
Auslöser war ein Filmdreh. Troller, dem wegen des geplanten Abrisses der Zugang zum alten Café Central behördlich verwehrt wurde, ließ sich mit seinem Filmteam heimlich im Gebäude einschließen und wurde nächtens in einem Kellerraum fündig: Dort fand er sie aufbewahrt, die Überbleibsel des alten Caféhauses, die Tische, die Schachbretter, Garderobenständer, Geschirrteile, die alte Kasse, „sogar eine Originalnummer des expressionistischen Sturm„, und unter dem Teppich ein Mosaik: „Eingang Café Central“. Damit beginnt das Buch, „Der Neubeginn 1918 – 1924“ heißt das Kapitel, und man ahnt bereits dort, dass der Neubeginn keiner sein wird.
Das Café Central war, wie Polgar sagt, gelegen „unterm wienerischen Breitengrad am Meridian der Einsamkeit. Kein Caféhaus wie andere Caféhäuser, sondern eine Weltanschauung, und zwar eine, deren innerster Inhalt es ist, die Welt nicht anzuschauen. Seine Bewohner sind größtenteils Leute, die allein sein wollen, aber dazu Gesellschaft brauchen.“
Wir begegnen den klingenden Namen damaliger Stammgäste: Schnitzler, Werfel, Kraus, Musil, Kisch, Kuh, Torberg, Friedell, Klimt, und und und. Ein intellektueller, überwiegend jüdischer Zirkel.

Eine große Zahl ebenso großer Namen fliegt en passant vorbei, von Fritz Lang bis zu Conrad Veidt, von Gustav Mahler bis zu Arnold Schoenberg, von Kurt Tucholsky bis zu Erich Kästner. Ein spezieller Favorit Trollers ist der jüdische Kabarettist und Autor Jura Soyfer, „der Wundermann“ (Troller), dessen Weg quer durch das ganze Buch immer wieder beleuchtet wird. In jenen Zwischenkriegsjahren gehörte Soyfer zu den produktivsten Wiener Satirikern, im winzigen Kabarettkeller ABC fand man ihn ebenso wie im renommierten Ronacher. Seit Urzeiten habe ich Soyfers literarisches Werk im Regal stehen, zwei schmale Bände, Lyrik und Prosa. Denn zu mehr kam er nicht: Beim Versuch, auf Skiern in die Schweiz zu flüchten, wurde er entdeckt. Er starb 1939 im KZ Buchenwald. (Die Wiener Band Schmetterlinge widmete ihm eines ihrer besten Alben: Verdrängte Jahre — Österreich zwischen den Kriegen; erschienen 1981; mit etwas Glück kann man die LP manchmal noch gebraucht finden.)
„Geh’ma halt a bisserl unter“ heißt einer von Soyfers bissigen Kabaretttexten. Er weist den Weg in den Fortgang der Geschichte: in den Untergang, der sich dann aber leider nicht nur als a bisserl erwies. Am Anfang stand, was Karl Kraus als „Die Ratten betreten das sinkende Schiff“ bezeichnete — die vor den aufkommenden Nazis nach Österreich fliehenden Deutschen nämlich. Ihre Flucht half ihnen nicht, denn die Fluchtursache folgte ihnen — und sie wurde willkommen geheißen.
Troller schildert dieses Umkippen der österreichischen Gesellschaft bis 1938. Er selbst gehörte zeitweilig zur Bündischen Jugend: „Wir waren inmitten von lauter fanatischen Mitläufern, sowas wie ein Stück Basisdemokratie: Frühhippies, Ökologen, Aussteiger, Widerständler, Selbstverwirklicher.“ Es war eine sehr ambivalente Bewegung. Sie ließ sich in Teilen einkaufen, und damit passte sie ins allgemeine Bild. Troller schildert die immer weiter zunehmende Bereitschaft der Österreicher, sich mit den neuen Herren zu arrangieren. Ihre Gemeinheit, ihre Kleinkariertheit, die Politisierung jeder gesellschaftlichen Banalität, der zunehmende Antisemitismus, der in offenen Judenhass kippte.
Und jeder, der heute mit offenen Augen durch die politische Landschaft läuft, wird zusammenzucken, wie aktuell das alles wirklich ist.
Georg Stefan Troller:
Das fidele Grab an der Donau
Mein Wien 1918 – 1938
(inkl. zwei Fotostrecken)
Artemis & Winkler, Düsseldorf und Zürich 2004
ISBN 3-783538-07188-9