Uncategorized
The Ways of Ostinato

Victor Vasarely
|
The most famous (and sophisticated) ostinato is without doubt Maurice Ravel’s BOLERO composed almost 100 years ago in 1928. Originally written as ballet music for the Ukrainian dancer from Kharkiv, Ida Rubinstein (1885-1960), it became an influential model for a lot of later music (and also is quoted lot). It seems that Ravel (1875-1937) was not really satisfied with the piece as such but nonetheless he put in a lot of sophistication. Yes, the piece is rotating around its own axis in a seemingly endless way, but it comes to a quite consistent and brilliantly percussive end (while its basic pattern will be resounding in listeners‘ mind for a while, or even restart). It feels in a way as ’stuck‘ and at the same highly mobile. It’s also a good example for the musical base principle of ‚rhythm is the master, melody is the servant‘.
Even if you have internalised it, it’s worthwhile to give it a listen from time to time, especially the version of Pierre Boulez (w/ Berlin Philharmonics) – to discover its sophistication (listen HERE). And, for instance check also versions of Frank Zappa, the one of the Barcelona concert (watch HERE), and the one with a slight reggae undercurrent (watch HERE). When listening to the Zappa versions, it becomes evident that not only Stravinsky (1882-1971) but also Ravel laid some groundwork for later rock music (and jazz too – Charlie Parker used to insert Stravinsky parts in his live concerts). Stravinsky about ostinatos: „It is static -that is antidevelopment, and sometimes we need contradiction to development.“ Stravinsky used ostinatos to confound rather than conform rhythmic expectations. HERE a Stravinsky example („Three pieces for string quartet“). More of Stravinsky, rock and jazz you can hear in STRAVINSKY TO GO, one of my archived radio programs (listen HERE). Debussy (1862-1918) had his very own take of ostinato. To experience HERE in his „Des pas sur la neige“ with its fascinating tempo.
For Frank Zappa, ostinatos had a further reaching function in creating his own music as his memories of listening- and creating processes leading into the creation of the FREAK OUT album of the Mothers. This is what Zappa said about it:
I think my playing is probably more derived from the folk music records that I heard – Middle Eastern music, Indian music, stuff like that.
For years I had something called Music On The Desert Road [Deben Bhattacharya], which was a recording of all kinds of different ethnic musics from different places in the Middle East. I used to listen to that all the time – I liked that kind of melodic feel. I listened to Indian music, Ravi Shankar and so forth, before we did the Freak Out! album. The idea of creating melody from scratch based on an ostinato or single chord that doesn’t change, that was the world that I felt most comfortable with.
“If you listen to Indian classical music, it’s not just pentatonic. Some of the ragas that they use are very chromatic, all sustained over a root and a 5th that doesn’t change, and by using these chromatic scales they can imply all these other kinds of harmonies. The chords don’t change; it’s just the listener’s aspect that gets to change based on how the melody notes are driven against the ground bass.” (Guitar World Interview (1993))
Another famous and well-known ostinato is the piece TAKE FIVE written by Paul Emil Breitenbach aka Paul Desmond and recorded by the Dave Brubeck Quartet in 1959. It’s in 5/4 time signature and takes about 5 minutes to play (listen HERE). The title also alludes to the saying meaning ‚take a little nice break‘.
Maybe after having given these two significant examples, other ostinatos pop up from your memory considered that ostinatos leave string memory traces and you get an idea over the ways and power of ostinatos. Here are more precious examples from recent past. The first one is from 1977 and even entitled „Ostinato“ (VIDEO) from the album SCALES (1976, Japo/ECM): it’s played by trumpeter Manfred Schoof, keyboardist Jasper van ‚t Hoff, bass clarinetist Michel Pilz, bassist Günter Lenz and drummer Ralf Hübner (recorded at NDR workshop). The piece can be considered as a blueprint for later electronics-based pieces in jazz. SCALES, released on vinyl prior to the CD-age, is still preserved in my Lp-collection.
Another piece i like to present, is LABYRINTH by Greek pianist Tania Giannouli. It’s recorded with her trio of oud-player Kyriakos Tapakis and trumpeter Andreas Polyzogopoulos on the album IN FADING LIGHT. There is also a live recording from Berlin Jazzfest 2018 in the A-Trane club (the concert was by the way attended by David Sylvian). A strong example, Carlos Bica’s BELIEVER has already been presented on Flowworker (watch HERE).
Ostinatos provide a continuing base element above which extensions flourish – both interacting and intertwining in dialectical manner. As listener you might not notice it consciously but you can be carried and uplifted by it. It should become clear that repetition plays a crucial role in different kinds of music. It can serve as anchor and at the same time be used to increase suspense depending on how sophisticated it is applied. Another famous example for sophisticated repetition, that remains firmly in many people’s memory is SO WHAT by Miles Davis (listen HERE).
Rock is still stronger entrenchend in the use of repetitive patterns. As an example I take here WHO DO YOU LOVE, a piece by Bo Diddley in the (short) version of Quicksilver Messenger Service: listen HERE.
Ostinatos can also be found in Sub-Sahara music. These ostinatos contain offbeats or crossbeats that contradict the main metric structure. Illustrative examples are reserved for another contribution. Further attractive, illustrious or instructive examples can gladly be added in the comments. I am aware that this post is peppered with music links. You can use it selectively, successively or as a travel through different times and genres.
As encore here an example by my beloved Giovanni Girolami Kapsberger (1580-1651) – watch HERE
McCabe & Mrs. Miller (6/10)
Eigentlich wollte ich meine zehn Lieblingswestern ( bis Nikolaus steht die Liste) für sich sprechen lassen, mit einem ausgewählten kleine Dialog, der nicht unbedingt auf Tiefsinn versessen ist – guter Humor und eine Prise Slapstick tuen es auch. Aber ab und an lasse ich mich selber kurz vernehmen, wie hier. Die Criterion-Fassung dieses Westerns von Robert Altman hat fantastische Extras.

Wann sah ich den Film das erste Mal? Unvergesslich. Im Audi Max der Uni Würzburg, in den wir fast jeden Mittwoch strömten, um uns von einem begeisterten Cineasten einleitende Worte erzählen zu lassen, und dann einzutauchen, in kühne, experimentierfreudige Filmwelten jenseits des Mainstreams. “The first time I talked about it with Robert we said it should look like the late 1800s,” erinnert sich Robert Altmans legendärer Kameramann Zsigismond. Und dazu sollten sich (dachte Robert) verdammt zeitlose Songs gesellen, die uns Hippies sowieso schon ewig begleiteten, gerne mit Räucherstäbchen. Aber es war genial, dass Cohen auf einmal in einem Western auftauchte (die ich schon als Kind liebte, als ich jeder Folge von „Am Fuß der blauen Berge“ entgegenfiebete). Und Leonard war in mancher Hinsicht der unsichtbare Erzähler von „McCabe & Mrs. Miller“. Was für ein anderer, radikaler Western. Es passt, dass die Texte der drei Cohen-Lieder surrealer sind als die erzählte Geschichte – die Handlung wird bereichert mit Symbolen, die Figuren gewinnen an Tiefe durch die Perspektive der Songs. Alle stammen aus dem ersten Album des gebürtigen Kanadiers – Robert Altman spielte die Platte so oft, dass er das abgenutzte Vinyl immer wieder ersetzte. Die Songs schleichen sie sich ein wie Erscheinungen, verbinden sich mit der „inneren Erzählung“, alles klingt an – Dankbarkeit, Trennung, Zärtlichkeit, Vision, Bedauern. Ein in aller Langsamkeit berauschendes Abenteuer für Augen und OhrenFrom Silverado (No. 5/10)
- (Kevin Kline) „You’re wearing my hat. What else you got that’s mine?“
- (Hat Thief) „Mister, I don’t know what you’re talking about.“
- (Kevin Kline) „I hope your fingers aren’t tickling my ivory handled Colt. You stand up real slow and let me see and you might live through this night.“
- (Hat Thief) „Sure“
Weiter im Takt mit Bro vor und zurück
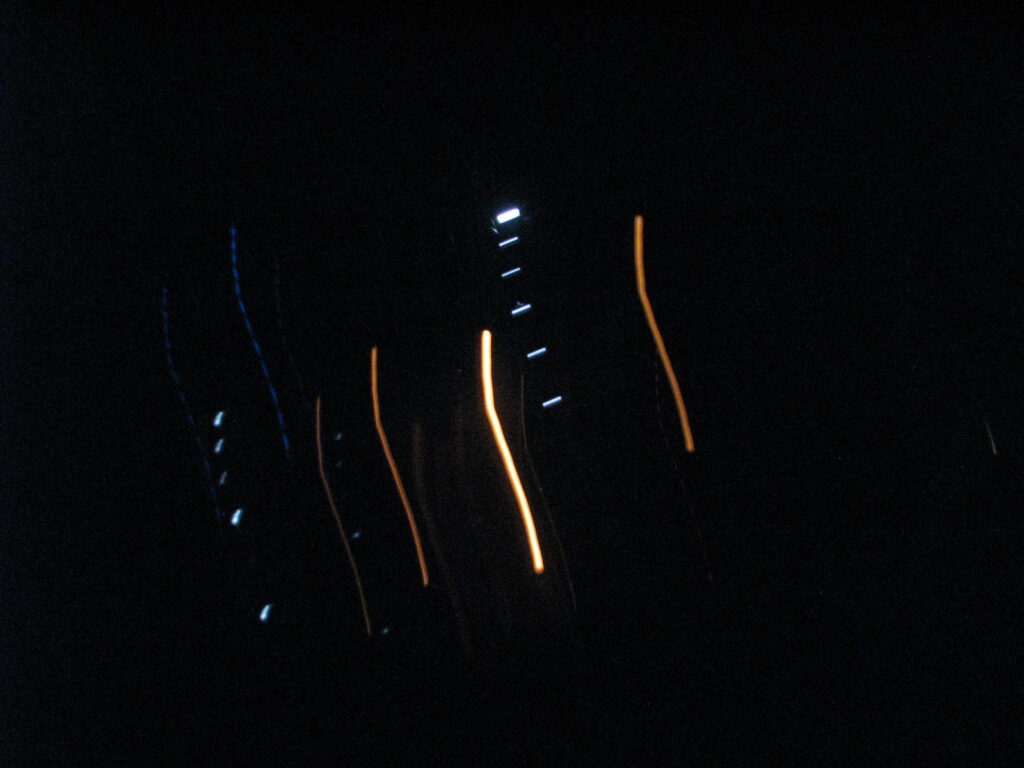
©️
Bro ist z.Z. in einem erstaunlichen Aktivitätsfluß qua Auftrittsanzahl, Auftrittsorten und Varietät an Besetzungen (Übersicht HIER). Was Besetzung betrifft, treten bei der bevorstehenden STRANDS-Tour Trompeter Arve Henriksen und Saxophonist Jesper Zeuthen (1949) an die Stelle von Trompeter Palle Mikkelborg (1941). Zeuthen, mit dem Bro eine längere musikalische Verbindung hat, ist eine Art Geheimwaffe, die in verschiedensten Projekten von Bro immer wieder zum Einsatz kommt. Zeuthen hat einen eher rauheren Ton.
Auf Bros eigenem Label Loveland ist gerade ein ‚dänisches‘ Album, „Sound Flower“, mit Saxophonist Jesper Zeuthen, dem Bassisten AC (Anders Christensen) und Perkussionistin Marilyn Mazur erschien. Zu sehen (Video) und zu hören auf Bandcamp.
Ebenso kommt ein langjähriger musikalischer Weggenosse von Bro, der Bassist Anders Christensen aka AC, zur Zeit vermehrt wieder zum Einsatz. AC führte Bro einst bei Paul Motian für dessen Electric Bebop Band ein, in der Bro in einer Reihe von anderen Gitarristen (Ben Monder, Brad Shepik, Steve Cardenas, Kurt Rosenwinkel) spielte. Von der E.B.B.B. erschienen 6 Alben bei Winter&Winter. Bro spielte in der letzten Phase in der Gruppe, ist aber nur auf einer Aufnahme der Folgegruppe, der Paul Motian Band, dem nach wie vor erstaunlichen Album „Garden of Eden“ (ECM 2006) mit gleich drei Gitarristen (Bro, Ben Wonder, Steve Cardenas) dabei. Als ich Paul Motian 2007 in New York traf, verkündete er erfreut, dass er in der Gruppe jetzt mit gleich drei Bassisten spielte. Das Erstaunliche war, dass die Musik mit diesen Mehrfachbesetzungen auf allen Instrumenten (ausser Drums) immer leichter klang.
Jesper Zeuthen führt uns auch zurück zu Bros Tentett, das er um den dänischen Dichter Peter Laugesen herum formierte in der Besetzung Jakob Bro (G), Peter Laugesen (gesprochenes Wort), Jesper Zeuthen (Sax), Andrew S’Angelo (Sax), Chris Speed (Sax), Nikolaj Torp Larsen (Tasten), AC (B), Thomas Morgan (B), Nicolai Munch-Hansen (B), Jakob Hoyer (Dr), Kresten Osgood (Dr). Davon ist 2015 das Album „Hymnotic/Salmodisc“ erschienen, das auf Bros Website immer noch gratis runtergeladen werden kann und eine ganz andere Seite von Bro erlebbar macht. Mit diesem Projekt geht Bro nun in leicht veränder- ter Besetzung u.a. mit belgischen Musikern auch wieder auf Tour. Diese Verbindung mit Poesie hat eine dänische Tradition.
Paul Motian hat ja nicht nur über Bro tiefe Spuren in Dänemark hinterlassen. Nikolaj Torp Larsen gehörte Anfang der 2000er der dänischen Gruppe Once Around The Park (Jakob Dinesen, Rune Harder Olesen, AC, Michael Finding, Rune Funch), benannt nach einer bekannten Komposition von Paul Motian, die Bezug nimmt auf Pauls Gewohnheit von seiner Wohnung am oberen Ende von Central Park West Richtung Harlem im Central Park zu joggen.
Weiters wird Jakob Bro beim Jazztopad Festival in Wroclaw zusammen mit Ambrose Akinmusire, Isaiah Collier, Brad Jones und Joanne Brackeen Teil des Shape-Of-Jazz-To-Come Orchesters von Denardo Coleman, dem Drummersohn von Ornette Coleman, sein. Beim Winterjazz Festival von New York im Januar wird er mit Mark Turner, CraigTaborn und Marcus Gillmore spielen. Schliesslich ist im Februar wieder die inzwischen übliche einwöchige Residenz im Village Vanguard in Manhattan angesagt.
Christmas in Scotland (in the 1970s)

In ihrem Kurzfilm Gasman zieht uns Lynne Ramsay mit den ersten Einstellungen ganz in die häusliche Szenerie und Unruhe einer Familie im Aufbruch. Schwarze Lederschuhe, von einem Mann im Unterhemd geputzt, werden scharfgestellt. Die Stimme der Mutter mahnt zur Eile. Jemand streut weißen Zucker in ein Spielzeugauto. Das Bügelbrett steht in der Küche. Das Mädchen ist noch nicht umgezogen. Innerhalb von Minuten erinnert sich der Körper daran, wie es war, eine Baumwollstrumpfhose anzuziehen, wie es war, wenn die Mutter dabei half, ein Kleid über den Kopf und über den Körper zu streifen. Der Film fängt die Atmosphäre der 70er Jahre in Schottland durch alle Sinne ein und es fällt nicht auf, dass er erst Ende der 90er gedreht wurde. Die Kleidung und die Musik sind das eine, vor allem aber ist es die soziale Atmosphäre, der Umgang mit Kindern, und man fragt sich, wie sie mit der Gewalterfahrung weiterleben. Auch dafür gibt es erste Antworten. Die Spannung funktioniert untergründig. Die Bildsprache ist kunstvoll und raffiniert; gesprochen wird eher wenig. Umso aussagekräftiger sind Gesten und kleine Handlungen, die sich wiederholen. Und die Gesichter. Immer wieder war ich erstaunt darüber, was in einem Bildrahmen gezeigt und was weggelassen wird. Lynne Ramsay zählt schon seit ihren ersten Filmen zu der von der Kritik gefeierten Independentszene in Schottland. Zwei ihrer Langfilme habe ich schon bestellt: Ratcatcher und Morvern Callar. Der Soundtrack von Morvern Callar liest sich wie ein Wunsch-Mixtape: Aphex Twins, Can, the Mamas & the Papas und sogar Boards of Canada ist dabei. Hier ist der Link zu Gasman (ca. 15 Minuten). Für mich ist Lynne Ramsay eine Entdeckung.
Peter Thomas: The Tape Masters, Vol. 1
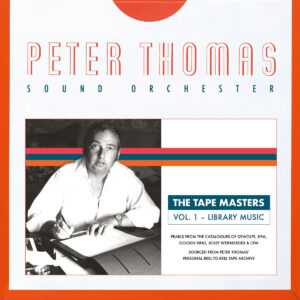
(in english language here)
Wer die 1960er und 1970er Jahre bewusst mitbekommen hat, der weiß mit ziemlicher Sicherheit, wer Peter Thomas war. Selbst wer den Namen nicht kennt, hat Musik von ihm gehört. Speziell wird jeder, der sich für Filmmusik im Allgemeinen interessiert, bei dieser Namensnennung aufhorchen.
Das Peter Thomas Sound Orchester (PTSO) war und ist ein klingender Name: Da war 1966 die siebenteilige TV-Serie Raumpatrouille, die natürlich jeder kennt (und sie bestand durchaus aus mehr als nur einem Bügeleisen), das Jahrzehnt brachte auch die Jerry-Cotton– und die Edgar-Wallace-Filme hervor, fester Bestandteil deutscher Trashkultur. Aber auch ein Meisterwerk wie Dr. Murkes gesammeltes Schweigen (nach der Satire von Heinrich Böll) stammt von 1964. Und die Durbridge-Straßenfeger. Nicht zu vergessen auch die grotesk-bombastische Constantin-Film-Fanfare. In den 1970ern kamen dann Der Kommissar, Derrick, Der Alte oder die ZDF-Show Der große Preis; im Kino gab es lausige Sex-Gurken wie den St. Pauli-Report, der Trash der Siebziger. Und überall hat das PTSO seine Spuren hinterlassen.
Nächstes Jahr wäre Peter Thomas 100 geworden. Das hat er leider nicht mehr ganz geschafft, 2020 hat er seine kosmische Adresse gewechselt. However, in jenen Jahren war er der deutsche Filmkomponist schlechthin — hunderte von Musiken, ähnlich wie Andy Warhol in seinen frühen Jahren nahm er offenkundig jeden Auftrag an, der zu bekommen war und lieferte zuverlässig bestmögliche Qualität, je nach Zeitrahmen und Budget. Er war unglaublich produktiv, selten waren seine Musiken langweilig, sein Sound, seine Melodieführung war fast immer erkennbar. Nicht selten waren seine Musiken besser als die dazugehörigen Filme.
Letzteres verdankt sich nicht zuletzt den Musikern, mit denen er immer wieder zusammenarbeitete, stellvertretend für etliche seien Lothar Meid, Klaus Doldinger, Otto Weiß, Olaf Kübler, Jan Hammer, Ingfried Hoffmann und Albert Mangelsdorff genannt. Denen ließ er, anders als andere Komponisten, große Freiheiten; nicht selten basierten seine Musiken auf Leadsheets, über die mehr oder weniger improvisiert wurde. Mit Eminenzen wie den genannten ging das. Aber auch die Arbeit mit Big Bands und Rundfunkorchestern hatte Thomas penibel drauf. Er war flexibel genug, mit allem zu arbeiten, was sich anbot.
Und doch fällt in seinen Musiken eine Vorliebe für bestimmte Standardbesetzungen auf: eine Rhythmusgruppe mit Solisten wie den genannten, dazu elektronische Orgel (selten mal ein Klavier), E-Gitarren, E-Bass, dazu Bläser, fast immer drei oder vier Posaunen. Deren Klang war durchaus prägend, das Ganze dann garniert mit viel klingendem Metall, Röhrenglocken, auf der Kuppe angeschlagenen Becken, dazu textlos singende, hohe bis sehr hohe Frauenstimmen (die waren in den 60ern en vogue), alles zusammen übergossen mit kathedralartigem Hall. Das war der Sound Peter Thomas‘. Man erkannte ihn sofort.
Aber er hatte auch einen Draht zu klanglichen Experimenten. Für die Raumpatrouille verwendete er einen Vocoder. Vermutlich war er damit der erste Musiker, der ein solches Gerät in der Musik einsetzte, lange vor Kraftwerk. Zusammen mit dem Wiener Ingenieur Hansjörg Wicha entwickelte Peter Thomas das Thowiphon, ein Tasteninstrument, das bereits den später entwickelten Synthesizer vorwegnahm.
Und weil das alles noch nicht reichte, spielte Peter Thomas über seine Auftragskompositionen hinaus unter mehreren Pseudonymen auch sogenannte Archivmusik, auch Stock Music oder Library Music genannt, ein. Darunter sind Kompositionen zu verstehen, die bestimmte Stimmungen und Atmosphären wiedergeben, auslösen oder unterstützen. Sie stehen dann in Musikarchiven zur Verfügung, katalogartig sortiert nach Kategorien wie „Abendstimmung“, „Verfolgungsjagd“, „romantische Liebe“, „Weltall“ und was immer man sich sonst noch vorstellen mag. Werbespots, Wissenschaftsdokumentationen, Tierfilme et cetera geben selten Originalkompositionen in Auftrag, sie greifen stattdessen auf solche Archivproduktionen zurück.
Und einige dieser Archivmusiken von Peter Thomas sind nun erstmals erhältlich. Sein Sohn Philip, der sich seit einigen Jahren dahinterklemmt, Thomas‘ hunderte hinterlassene Tonbänder durchzugehen, zu restaurieren und sie sinnvoll zusammengestellt zu veröffentlichen, hat jetzt 25 solcher Archivtracks zusammengefasst.
Diese Tape Masters Vol. 1 bieten auf zwei 10-inch-LPs einen Querschnitt durch Thomas‘ Archivschaffen, und man staunt, wie vielfältig das ist. Große Besetzungen wechseln sich ab mit kleinen Combos, elektronische Experimentierereien kontrastieren mit eher hingeworfenen Skizzen, Klänge, die an Auftragskompositionen anknüpfen, folgen auf völlig eigenständige Werke, satter, jazziger Bigbandsound folgt auf Harfenklänge, Zupfgeigen oder spacige Weltraumsounds in der Nachfolge des Raumschiffes Orion, auch ein schräger „Nightmare on LSD“ ist zu hören. Die meisten Stücke bewegen sich zwischen 1:30 und 2:30, zu hören inzwischen auch in den üblichen Streamingdiensten.
Diese Scheibe ist schon jetzt ein ziemlich sicherer Kandidat für meine Jahresliste. Unbedingte Empfehlung.

Thomas, Odilo, und ich machen es wieder!
Erst mal ein paar Tassen Kaffee für das Jazztrio des Deutschlandfunks in der wilden Kantine unseres Senders. Kühne Girlanden und ein Hauch von Dschungel bereiten den Boden für dezenten Enthusiasmus! Im Dezember setzen wir uns wieder zusammen, am 19.12. um 21.05 Uhr wird gesendet (und das ist dann die geschnittene Version unserer Studioaufnahme), und stellen uns unsere drei Lieblingsalben des Jazzjahres vor. Wir geben uns Sekt oder Selters. Es gibt Konsensalben und heiter-freche Diskurse, wenn man mal so gar nichts mit einer Platte anfangen kann.

Es gibt nun mal keine vollends abgesicherten Parameter, nach denen man eindeutig das Allerbeste, zum Beispiel im Jazz, auf den Punkt bringen kann. Ich persönlich liebe es, wenn mich ein Jazz- oder jazzhaltiges Album seltsam berührt, seine Zeit braucht, ein paar Widerstände überwindet, dabei etwas Undefinierbares ins Spiel bringt, so geschehen bei dem aktuellen Album der blutjungen Nala Sinephro. Dann wieder gibt es Alben, die mich bei aller „hohen Kunst“ seltsam kühl zurücklassen. Natürlich entgehen mir jedes Jahr ein paar wunderbare Alben, das passiert halt bei der Fülle der Angebote.

plus:Jakob Bro: Taking Turns
Charles Lloyd: The Sky Will Be There Tomorrow
Eric Chenaux: Delights Of My Life
Anna Butterss: Mighty Vertebrate
Patricia Brennan: Breaking Stretch
Sidsel Endresen: Punkt Editions, Vol. 2
Kalma / Chiu / Honer: The Closest Thing To Silence
Wayne Shorter: Celebration, Vol. 1
Vijay Iyer: Compassion
Und so waren alsbald meine zwölf, hups, dreizehn Kandidaten formuliert, und die grösste „Not“ elebte ich, als ich bei der Suche nach meiner Nummer Drei zwischen Nala und Eric zu wählen hatte. Fast hätte ich eine Münze geworfen, letztlich gab den Ausschlag, dass ein Drei-Minuten-Ausschnitt aus „Delights Of My Life“ kaum reichen könnte, um unter die Oberfläche dieser zauberhaften Arbeit zu gelangen. Jakob Bros Album liess ich nicht mal in die Nähe meines „olympischen Treppchens“ kommen, weil ich diese Produktion Anfang Dezember in den JazzFacts von Odilo bespreche.Ausserdem habe ich erstmals erschienene Archivausgrabungen aussen vorgelassen, sonst hätten Alice Coltrane mit ihem Carnegie Hall Konzert 1970, und Keith Jarretts Trio mit dem 30 Jahre alten „The Old Country“ ein Wörtchen mitgeredet. Die Überfülle von Jarretts Trioalben war ich irgendwann leid, aber nachdem ich lange keine Album mehr mit diesen „Standardsbesessenen“ gehört hatte, haute mich diese Aufnahme aus einem alten kleinen, von Jarrett innig geliebten, Jazzclub mit der hörbar-irren Spielfreude regelrecht um. Nebenbei bemerkt, eine absolut audiophile Aufnahme: Hammersound, Hammerbebop und mehr!
So weit, so gut. Ich machte Thomas L, heute den Vorschlag, am Ende solle jeder in zwei Sätzen eine viertes Album seines Vertrauens präsentieren, da wäre bei mir Anna noch gross ins Rennen gekommen, mit ihrem famosen Opus auf International Anthem, dass man leicht als „shubby-groovy“ und „westcoasteasy“ abtun könnte, wäre da nicht… aber das führt jetzt zu weit. Ausserdem war diese Idee etwas egoistisch: ich hätte meinen „Dreiklang des Meditativen“ (Fred, Shabaka, Nala etwas aufgerüttelt mit dem cool-smarten „Querfeldein-Gewirbel“ von Anna Butterss (slightly inspired by Brian Eno‘s Oblique Strategies)!
Artistic development emerging/unfolding in vivid scenes
„In 1975, an iconic moment unfolded in the vibrant cultural tapestry of Greenwich Village, capturing the convergence of two legendary figures in music and poetry: Bob Dylan and Patti Smith. The photograph taken by Ken Regan in a stairwell during a party at Allen Ginsberg’s loft encapsulates the energy of an era defined by artistic rebellion and innovation. Dylan, with his enigmatic presence, had an undeniable impact on those around him, and his entrance into the room sparked a sense of empowerment in Smith. As she recalls in her memoir ‚Just Kids,‘ the knowledge of Dylan’s presence filled her with a sense of worth and connection, reinforcing her own identity as an artist alongside her band. This night was not just a casual gathering; it was a celebration of creative kinship that embodied the spirit of the times.“
„The meeting between Patti Smith and Bob Dylan at the Bitter End marked a significant milestone in her burgeoning career. Dylan, known for his elusive nature, rarely attended shows, making his presence a rare honor for Smith and her band. This encounter was pivotal, as she noted, ‚It was sort of a big deal, because Bob Dylan didn’t really go to see anyone.‘ Their subsequent walks and conversations allowed Smith to relate to Dylan on a deeper level. She recognised a shared artistic vision and a melding of poetry with performance that both artists embodied. This connection not only inspired Smith but also laid the groundwork for her own evolution as a musician and poet, affirming the power of collaboration within the artistic community.“

„Reflecting on their initial meeting, Smith vividly recalls the nerves and excitement of encountering a musical icon she had admired since her teenage years. ‚I mean, I loved Bob Dylan since I was 16 years old,‘ she stated, describing the moment he walked backstage. The encounter was both thrilling and intimidating, leading to a humorous exchange that revealed her playful personality. Her about disliking poetry was a defense mechanism, akin to a schoolyard crush, showcasing the mix of admiration and vulnerability she felt in Dylan’s presence. This light-hearted banter laid the foundation for a genuine friendship, emphasizing the human side of these cultural titans.“
„Bob Dylan’s support for Patti Smith and her band played a crucial role in propelling them into the limelight. His presence at their shows and subsequent endorsement brought significant attention, ultimately contributing to their eventual record deal. As Smith reminisced, his actions inspired others to take notice, proving that the endorsement of a respected figure like Dylan could open doors in the competitive music industry. This moment was emblematic of how relationships between artists can transcend mere admiration, leading to opportunities that alter the course of one’s career.“
„The friendship that blossomed between Smith and Dylan exemplifies the artistic camaraderie that characterized the vibrant scene of the 1970s. Their shared experiences in New York City’s creative crucible fostered a mutual respect for each other’s artistry. Smith’s acknowledgment of Dylan’s ‚arrogance‘ and ‚humor‘ reflects the complex nature of their bond, allowing her to embrace the idiosyncrasies of a man whose influence loomed large over contemporary music. As they navigated their individual journeys, their connection served as a reminder of the profound impact artists can have on one another, shaping their trajectories in unpredictable ways.“
„Today, as we look back on this pivotal encounter, it serves as a reminder of the interconnectedness of art and the powerful relationships that can emerge from shared passions. Patti Smith’s collaboration with Bob Dylan not only enriched her artistic vision but also highlighted the importance of community within the creative landscape. Their story continues to inspire aspiring musicians and poets, illustrating that even the most figures began their journeys through authentic connections, laughter, and a mutual appreciation for the transformative power of art.“
SOURCE: Historic Lens Stories
Podcast Update
Listen to the first verse of Try a Little Tenderness by Otis Redding. (… I)t starts hesitatingly, the rhythm isn’t quite settled, Otis doesn’t quite know where to come in exactly, you know? And then the first notes on the guitar and the bass are kind of off slightly. And then it kind of congeals and comes together so that by the start of the second verse, it’s just this magical thing. And the progress from A to B is just this journey that is so moving. And you can feel the humans.Nach dem Lesen von Ingos Reisebericht habe ich mir den Podcast von Marc Maron angeschaut und bin gleich bei dem Interview mit Joe Boyd kleben geblieben, aus dem das Zitat kommt. Genau so gerne habe ich vor kurzem dieses unterhaltsame Gespräch mit Michael Pollan gehört.
