Uncategorized
Bevorzugte Farbe: Blau
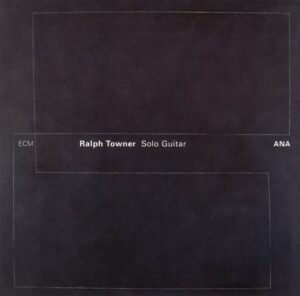
That was the title of an old Ralph Towner portrait of mine, now found with the help of Thomas Loewner in the deep archives of the radio station. It was exactly 30 years ago when the show was recorded and broadcasted. February 1996, few weeks after the release of his collaborative work „Lost and Found“. I‘ve heard this thing for the first time now since then. No surprise, that „blue hour“ included some of my favourites like „Solstice“, „Diary“, or „Solo Concert“. A la recherche du temps perdu: while listening, I remembered the relaxed atmosphere of the interview in Dortmund, where he played a solo concert in the old „Domicil“. Ralph took his time to unfold thoughts and memories: the early years with Oregon, his first encounter with the 12-string, a detailed look at his way of composing and improvising solo. What you won‘t hear, is his deep and telling sigh when I mentioned „Solstice“. I will post the portrait here within the next seven days. He spoke about another pure guitar solo album to be recorded soon. „Ana“, produced by Manfred Eicher in Oslo, was released in 1997 – and what a beautiful album that one is! Ask Mr. Whistler!Thoughts on the inestimable loss of two musical giants


In the past month we lost two great jazz artists and composers, Ralph Towner and shortly after, Richie Beirach. Both of these artists were players with an original voice. One could immediately identify them within the space of just a few notes.
However, It’s not just a signature sound as a player which defines a great jazz artist – their unique musical vocabulary is also reflected in their compositions. Not every great player can write a memorable tune, especially one which other artists want to incorporate into their repertoire. Both of these artists wrote tunes that were as easily identifiable as the way they played; in fact they are really two sides of the same musical coin. Richie Beirach once said that most composers only have one song they’re continually rewriting and If they’re lucky they might have two or three. While there is truth to this statement, I think both of these artists broke that rule, especially Towner.During the lockdowns, Richie and I became email pals. After I mentioned that I had a lot of his albums, he would send me a YouTube video of one of recordings with the challenge, “Got this?” Even though I have an extensive collection of his music, all too often I didn’t have the album in question, and in many cases didn’t even know it existed. It became a game, and over time he revealed to me the vast scope of his discography, which included some 100 albums as a leader or co-leader, not to mention a huge discography as sideman. While not known for being super prolific, in fact he wrote over 300 tunes, of which at least 200 are recorded.
Ralph Towner had been equally busy over the course of his career, both as a member of the ground breaking world jazz group Oregon, as well as leader on a number of group projects, as a solo artist and sideman on countless projects. He too penned over 300 tunes. I was visiting Paul McCandless a couple years ago and when I mentioned Towner, he said that pretty much any time of the day or night, in all likelihood Ralph was writing yet another tune. He never stopped. This is reflected by the fact that throughout Oregon’s nearly 50 year life span, the vast majority of their repertoire was written by Towner.
It was not my intention to compare these two. Yet despite the fact that both were mavericks and in most ways as different in their approach as could possibly be, there are some similarities.
The overlap begins with the fact that both were strongly influenced by classical music, Richie mostly by the Romantics and modernists like Bartok and Stravinsky. Besides the album Round about Bartok, Richie also made recordings titled Round about Mompou and Round about Monteverdi. His jazz influences were extensive, but Bill Evans stands out. Richie had a personal relationship with Evans and it left an indelible mark on his aesthetic sensibilities. In fact, both Ralph Towner and Richie Beirach have always mentioned Bill Evans as a primary influence. And it is interesting to note that Bill Evans himself was highly influenced by classical music, especially the so called impressionists such as Debussy and Ravel. And anyone who’s played their piano music or that of Frederico Mompou will immediately recognize the kinds of chord voicings used by Evans. So there’s a common lineage there.
Towner, a musical sponge, was influenced by just about everything: Elizabethan composers like John Dowland, but also Bach and Villa Lobos. One of the founding members of the world jazz group Oregon, Ralph’s influences were far ranging. He incorporated African, Brazilian, Caribbean, Greek and other world music influences into his compositions. Whereas with Richie Beirach, I have always heard more of an Eastern European classical vibe in his music. Besides Bartók’s influence, I also hear Chopin, Stravinsky, and even a bit of Schoenberg. In the jazz arena, I also hear Herbie Hancock, McCoy Tyner and on occasion, Monk.
And it is at this point the similarities end, and the differences become apparent. The most obvious difference between these two artists is the fact that Ralph Towner switched from piano to guitar in his early 20s. While Ralph always chose to play standards which he peppered with his compositions, he was in general a less mainstream jazz figure than Beirach, whereas throughout his career Beirach kept his attention on re-harmonizing and reworking standards as a large part of his repertoire, and tended to work in the trio format. While Oregon focused entirely on original compositions, Towner often included one or two standards regularly in his solo concerts and recordings and continued to do so all the way through to his last album. Also, unlike Richie Beirach, whose entire musical career revolved around the piano, besides nylon string and 12 string guitars, Towner also played electronic keyboards, percussion, occasional trumpet and French horn, and recorded several albums where he played all the instruments himself.
When a jazz musician passes, while their compositions live on as do their recordings, something dies with them; the unique lens through which these compositions sprang and were constantly reinvented is silenced forever. I know I will never again hear them play one of their own compositions live as only they can. While there are already a number of classical guitarists who are playing Ralph Towner’s compositions, for the most part they don’t improvise and simply play a written arrangement. These compositions hold up well enough to be given this formal treatment, but so much is lost. Ralph Towner never played one of his compositions the same way twice, which is why it was always such a kick to see him perform solo. Solo guitar is a difficult thing to pull off, but when it includes a great deal of improvisation, it’s like walking a tight rope without a net. Yet Ralph Towner did it with aplomb and was willing to take risks. Sometimes that resulted in a flubbed note, but it never bothered me in the least, because I always knew he was fearlessly going for it, and trying to be truthful to where his ear was leading him. Beirach had that same lightning fast intuition and risk taking mentality, and was always intent on finding a new way to interpret an old standard or one of his own tunes. In fact, Richie had such an original harmonic concept that Dave Liebman gave him the nickname, The Code. His was a unique musical DNA which infused everything he played. Like Towner, he had an innate ability to reinvent and re-interpret on the fly. Neither of these artists ever played it safe.
Even though we all know how fragile life is, I think most of us are always secretly hoping that those we love will somehow escape the inevitable. This is how I’ve felt about these two artists. Yes they were getting older, but I wanted them to live on, because they were still on fire and creating beautiful work. Surely that would send a message to the powers that be that they should be able to continue their earthly mission…
These days, too often I find myself saying that all my heroes are either really old or dead. And the dead list keeps getting ever longer. It’s easy to wax Buddhistic and ask, how could it be otherwise? The perennial truth is after all, impossible to ignore. And yet, I still find it difficult to accept the loss of these two great artists who have influenced my personal musical life and given me so much joy for so many decades. I console myself with the fact that they were both well recorded. One thing I know for sure, the legacy of these two giants will live on.
„Musique pour la cuisine du Philippe“
Ich habe den „heiligen Gral“ von Roedelius verkauft, sein Tonbandarchiv. Nach dem Gespräch mit dem Käufer (auch hier führt wieder mal ein Weg nach Ostfriesland) blicke ich nach draussen – alles schneeweiss. Es dunkelt, zwei Kerzen, und ich lege mal wieder „Lux“ von Brian Eno auf. Vier Plattenseiten fesselnde „Ambient Music“ aus den 2010er Jahren. Horizont und zugleich Heimat. Viele der späteren Ambient-Werke von Brian sind nicht weniger erstaunlich oder gehaltvoll wie die frühen Klassiker, sie hatten allein dem Nachteil, in einer Zeit zu erscheunen, in welcher das Genre „Ambient Music“ geläufig geworden war, und nicht mehr Teil eines aufregenden Diskurses.
Michael, you know, the music doesn’t progress, per se; instead, Brian’s meditative blend of wafting keys and sporadic bass stabs are mentally rejuvenating. There’s an overwhelming sense of calm here, and the album remains intriguing, though it never strays far from its sonic centre. Through it all, Lux harbours a big sound through a minimal existence.
In dem Restaurant nahe des Jardin du Luxembourg (25, rue Servandoni) fand ich mich am frühen Mittag ein, an einem heissen Sommertag des Jahres 2013, um noch einen der begehrten Tische zu ergattern. Ich hatte dem Tip von einem Freund bekommen, weil die Besitzerin mittags gerne, kein Scherz, keine Fantasie, Enos Ambient Music auflegte, im Hintergund, wo sonst, und es lief tatsächlich Lux“. Nur einmal hat mich Enos Musik an einem öffentichen Ort dermassen überrascht – in den Jameos Del Agua auf Lanzarote gehörte „Music For Airports“ zum Inventar des guten Tons im Café oberhalb der Höhle.
Und hier nun „Lux“. Das Interieur der Gastatätte liess ans Paris der 50er Jahre denken, und die gleichermassen herbe, in die Jahre gekommene, unnachgiebige Schönheit der Chefin ein altes Paris wachwerdrn, das Robert Wyatt einst besungen hat. Leicht konnte ich mir vorstellen, wie sie einst Julio Cortazar eine krosse Entenbrust servierte, und Erik Satie auflegte. Zu Beginn ein Gazpacho, das alles in den Schatten stellte, was ich mir bisher unter einer erfrischenden Gemüsesuppe (mit ungekochtem Gemüse) vorstellte. Und dann der Hauptgang: zuvor hatte ich mit meinem Schulfranzösisch identifiziert, dass es sich um Kalbsfleisch handelt, mit Pfifferlingen, in Madeira geschmort oder flambiert. Und, als ich es mir munden liess, wusste ich sofort: nur ein unangefochtener Meisterkoch bringt eine solch abgerundete Komposition zustande, das Fleisch „au point“, auf den Punkt gebraten – die Pointe aber war, schlicht und ergreifend: ich mag keine Kalbsniere. Dessen ungeachtet, kann ich „La Cuisine du Philippe“ wärmstens empfehlen. Falls alle noch leben, und es den Laden im Winter 2026 noch immer gibt. Allein daran habe ich meine Zweifel.
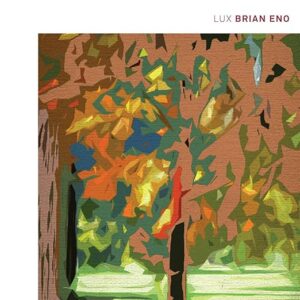
Vor wenigen Monaten, zog es mein etwas älteres Ich wieder in den Jardin du Luxembourg, in dem ich, und um den herum, ich genug Stunden der wahren Empfindungen erlebte, für einen sehr privaten Film voller Musik. Ich hatte das neue Werk der Necks dabei und legte mich zum Hören einss langen Stückes auf eine grosse Wiese dort. Als ich 20 war, sang und spielte dort im Park ein „hippie woman“ den grossen Song „Ohio“ von Crosby, Stills, Nash & Young. Ich sehe sie noch heute vor mir. Genauso wie die einstige Busfahrerin von Joe Zawinul, die ich dort im Quartier Latin kennenlernte, lang ist es her. Ich überquerte also, wieder und wieder in all den Jahren, die Rue Servandoni auf dem Weg zum Park, und vergass einfach, nachzusehen nach diesem alten Restaurant, das „Lux“ laufen liess an einem heissen Sommertag anno 2013. Das Cover allein, wie ein Blick in meinen Lieblingspark. „Warm Running Sunlight“. Prochain fois!Sirāt
Man muss aufpassen, wenn man sich grosser Themen annimmt – „between nothingness and eternity“. Ich glaube, genau so hiess das dritte Albums des Mahavishnu Orchestra, und seine Schwäche war das „overpowering“, die Musik wirkte hochtrabend, bedeutungsschwanger, und etwas hohl – kein Vergleich mit den beiden Vorgängern „The Inner Mounting Flame“ und „Birds Of Fire“. Oliver Laxe nimmt sich grosser Themen an auf Sirāt, und er benutzt dazu eine Geschichte, Sound, und die Sprache seiner Bilder. Nichts an diesem Meisterwerk ist hochtrabend.
Ein Wahnsinnsfilm. Vielleicht gelingt es mir, in meiner Ausgabe der Klanghorizonte im Mai ein Stück des Soundtracks aufzulegen. Aber was davor, was danach? Nicht leicht.
Jemand meinte kürzlich, ich würde wohl Filme danach bewerten, wie sehr sie mich emotional mitreissen. Das ist natürlich grosser Unsinn aus der Rubrik „gutartige Unterstellung“. Aber es gibt Filme, da hole ich gerne Erinnerungen hervor an Susan Sonntags Text „Against Interpretation“ ….
Es gibt Filme, da ist halt das erste, möglichst unvoreingenommene, Sehen, Erleben, Erfühlen eminent wichtig. Keine altkluge Hinführung, keine akademische Schubaldisierung …. Am hilfreichsten wären – vor einem Film wie Sirāt – ein paar Suggestionen, eine dezenteTranceinduktion a la Milton Erickson, für eine Reise, deren Ausgang niemand kennt.
Und jeder Leser dieser Zeilen schaue sich zu allererst SIRĀT an, lasse den Filn ein paar Tage und Nächte nachwirken, bevor, in irgendeiner Form, der „Analyse“ Raum gegeben wird, dem Drumherum …. und bevor man das weiter unten angegebene Interview liest. Oder die jetzt folgenden Zeilen, als „appetizer“ für ein hochinteressantes Gespräch! Also, STOP!!!!!
SIRĀT gibt es als blu ray, dvd, bei prime, und am besten, ab und zu, in einem Programmkino deines Vertrauens!

„Oliver Laxe spricht über Kino so, wie andere über Rituale sprechen. Das Kino ist für ihn eher ein „Tempel“ als ein Ort der Freizeitgestaltung. Er spricht in Rätseln, wenn er Gestalttherapie, Sufi-Mystik, Rave-Kultur und die Kraft der Bilder auf den Körper in einem Atemzug zusammenfasst. Immer wieder kehrt er zu der Idee zurück, dass Kino eher eine körperliche als eine rein intellektuelle Erfahrung ist. Diese Philosophie belebt Sirât, Laxes neuesten Spielfilm und sein bisher provokantestes Werk. Der Film spielt zwischen einer fast apokalyptischen Wüstenlandschaft und einer Underground-Rave-Party und entfaltet sich wie eine Feuerprobe, die die Zuschauer in Ekstase, Trauer und Erschöpfung treibt. Laxe setzte sich mit uns zusammen, um über seinen neuen Film, das Heilungspotenzial des Kinos und die Gemeinsamkeiten von Rave-Partys und Kino zu sprechen.“
Womit ich nicht gerechnet habe
Der Januar war noch nicht vorbei, da bin ich schon zweimal auf ihn gestoßen.
Erst fiel mir sein Bild unten rechts auf Seite 259 in dem Katalog „FMP: The Living Music“ auf. Ich stutzte, brauchte etwas das Gesicht mit dem markanten Schnauzer zuzuordnen und fragte mich, was der große Autor wohl mit Free Jazz zu tun habe.
Eine Woche später bekam ich eine E-Mail. Der Leiter einer Bildungsreise nach Danzig, an der ich Ende März teilnehme, gab Hinweise zum Ablauf und Lesetipps. Unter anderem die ersten beiden Bände der Danziger Trilogie von Günter Grass.
Als strebsamer Mensch bestellte ich mir dann „Katz und Maus“. Als ich F davon erzählte, war sein Kommentar dass er keine Bücher von Nazis lesen würde. Auch andere Gesprächspartner waren skeptisch, ob man Grass aus politischen Gründen noch lesen könne.
Ich habe da nicht ganz tief recherchiert. Grass war Mitglied der Waffen-SS und hat das erst recht spät – ungefähr 10 Jahre vor seinem Tod – zugegeben. Bei Kriegsende war er 17 Jahre, demzufolge bei Machtergreifung fünf, hat also das stark auf Indoktrination ausgerichtete NS-Bildungswesen voll durchlaufen. Hätte ich in der Zeit gelebt…, ich befürchte, dass ich überzeugter Mitläufer gewesen wäre. Er wurde zu Kriegsende eingezogen, war kein Funktionär und nach allem, was bekannt ist, kein Täter.
„Katz und Maus“ ist ein schmales Büchlein mit vielen Kapiteln, so dass man die Lektüre immer gut unterbrechen kann. Das Leben Jugendlicher in Kriegsjahren in Danzig wird teils sehr genau und teils fantastisch-magisch eingefangen. Mal wird gegenwärtig erzählt, mal die Hauptperson direkt angesprochen, mal aus der Erinnerung, so dass eine unwirkliche Atmosphäre entsteht. Und es ist sprachgewaltig; immer wieder mal habe ich mir unbekannte Worte übersprungen. Das Buch ist keine historische Rechtfertigung, eher eine Auseinandersetzung mit der Zeit.
Insgesamt hat mir „Katz und Maus“ so gut gefallen, dass ich mir heute „Die Blechtrommel“ gekauft habe. Auch dieses Buch hat zahlreiche Kapitel (47), allerdings auch sehr viele Seiten (in meiner dtv Ausgabe sind es 779 Seiten, dazu kommt dann noch ein Anhang). Mal sehen, ob ich das bis Ende März, dann fahre ich ja nach Danzig, gelesen habe.
Und wie kommt Grass in den FMP Katalog? Es scheint in den 70er und 80er Jahren auf verschiedenen Veranstaltungen zu Lesungen von Grass mit Jazz Musikern gekommen zu sein, auch mit Peter Brötzmann. Aufnahmen existieren mit Günter Sommer.
Einmal vor langer Zeit im Kino Endstation
“This film is concerned with the interior experiences of an individual. It does not record an event which could be witnessed by other persons. Rather, it reproduces the way in which the subconscious of an individual will develop, interpret and elaborate an apparently simple and casual incident into a critical emotional experience.”
— Maya Deren on Meshes of the Afternoon, from DVD release Maya Deren: Experimental Films 1943–58.This story is concerned with the interior experiences of an individual. An jenem Abend war ich mit einer guten Freundin im Restaurant des Bahnhofs, wohl heute noch ein kultureller in-Treff – Jan Garbarek spielte da schon, Tocotronic, und Faust (ein geniales Konzert spät in den Neunzigern). Irgendwie hatte ich, was ich sonst nie habe, eine Vorahnung, des öfteren schweifte mein Blick durch den Raum. Es war später Nachmittag, die Küche hatte bereits geöffnet, die Netze des Nachmittags waren weit gespannt. Nach einem kurzen Gang zum WC kehrte ich zurück an unseren Tisch, und, neben dem kleinen hölzernen Podium dort passierte es.
Wer jemals das luzide Träumen geübt hat, weiss, dass eine Basisübung die Prüfung des Wirklichkeitszustandes ist: Träume ich oder bin ich wach? Durch alle Sinneskanäle hindurch wird die „Realität“, besser, „der Realitätszustand“, kritisch hinterfragt. Keine fünfzig Meter neben dem Kino, das „Meshes of the Afternoon“ aufführte, spielte sich, in anderer, hier ungenannter Zeit, eine leicht surreale Situation ab.
Unsere Blicke trafen sich, und ich will nicht sagen, dass ich vom Donner gerührt war – vom Blitz getroffen war ich. Sie hatte Engelslocken – fernab meiner sonstigen, urtyp-definierten Jagdgründe ein blondes Wesen. Was tun, in Bruchteilen von Sekunden? Wir kreuzten uns, keinen Meter voneinander entfernt. Ich drehte mich um. sie drehte sich um. Wir standen da wie angewurzelt, schauten einander in die Augen. Die Zeit stand mucksmäuschenstill, es könnten drei Sekunden gewesen sein. Die nächste Drehung, absolut synchron, und jeder setzte den eigenen Weg fort. This story does not record an event which could be witnessed by other persons. Or on the surface only, bit by bit.
Ich entschied mich für die galante Variante, und eine Pointe, einen Knalleffekt, der Jean Pierre Leaud, Truffauts alter ego, würdig sein sollte. Es ist doch cool, eine romantische Seele zu sein, erfindungsreich und furchtlos. Ich zahlte zügig unsere Rechnung, kutschierte S. nach Hause, 15 Kilometer, und fuhr mit dezent angezogenem Tempo zurück zum Bahnhof. Nichts sollte mich aufhalten, selbst von einem vollbesetzten Tisch mit Kind, Hund, und Ehemann, würde ich sie kurz nach vorne winken. Es gibt in Max Frischs „Mein Name sei Gantenbein“ diese Gedankenspiele zu Alltäglichkeiten, in denen eine profane Verrichtung, ein Schritt nach links oder rechts, einem ganz anderen Lebenslauf auf die Sprünge helfen.Rather, this story reproduces the way in which the subconscious of an individual will develop, interpret and elaborate an apparently simple and casual incident into a critical emotional experience. So, wie sie mich angesehen hatte, war hier keineswegs die alte Tante Projektion im Spiel, vielmehr pures „Wahr-Nehmen“, ein erster Blick, der tausend weitere enthielt. Eine Prüfung von „Realität“ der Marke „a thousand kisses deep“. (Leonard war mein Lehrer. All die Abende in Babsis Dachboden, Jahre, Jahre zuvor, mit Cohens endlosen Drehungen auf dem Plattenteller, liefen auf diesen Moment hinaus, ich hatte den „Stranger Song“ auf den Lippen, „Suzanne“ sowieso, bereit jeden Millimeter zwischen dem Müll und den Blumen abzusuchen.) Ich war schwarz gekleidet, bereit zur Eroberung. Django in love. Nach Paris, mais bientôt, ein Dutzend Liebesgedichte, gerne ein Song aus der Hüfte, wäre ich Bob Dylan – und der Bund fürs Leben sowieso! Sie war nicht mehr da.
An den folgenden Tagen und Wochen war ich häufig wie nie im „Bahnhof Langendreer“, ich gab einer Studentin, die dort kellnerte, und sich was traute, 100 Mark, und versprach ihr eine Menge mehr, sollte sie den Engel im Raum ausfindig machen (sie bekam eine Beschreibung, zehn Karten mit meiner Telefonnummer, ich nannte sie meine „Liebesdetektivin“). Sie machte einen guten Job, schoss ein paarmal ins Blaue, wie sie mir erzählte, doch der Engel tauchte nie wieder auf. Ich hätte schlichtweg sofort handeln müssen, in the moment. „And you want to travel with her, and you want to travel blind.“
Bill Bruford, master drummer & storyteller
Irgendwie kam ich auf flowflow vor Tagen auf meine liebsten Interviewpartner im Laufe der Jahrzehnte zu sprechen, und da darf in meinem Top 10 der Drummer Bill Bruford nicht fehlen. Wunderbar allürenfrei, ein authentsicher Gentleman, ein Künstler, der in seinem Leben sehr verschiedene Klangwelten erforscht und mitgeprägt hat – und nebenher noch ein exzellenter Storyteller ist, inhaltliche Substanz und pointierte Darstellung einswerden lässt. Das ist auch hier zu erleben, wenn man ihm gut zuhört, wenn er vom King Crimsons Klassealbum „Larks’ Tongues in Aspic“ erzählt. Ich traf ihn dreimal, in Kristiansand und zweimal in Köln – ein Künstler, der sofort eine entspannte Interviewatmosphäre herstellt, seinem Gegenüber natürliche Wertschätzung entgegen bringt, und einfach nur der Traum eines Musikjournalisten ist, in der Hinsicht, dass er einen fantastischen OTON nach dem anderen liefert, bestechend analytisch und dezent humorvoll.
Mit King Crimson erlebte ich ihn in Nürnberg 1982 mit 30000 Zuhörern – neben Neil Young war das „Discipline“-Quartett das Highlight eines langen Festivaltages – und sechzehn Jahre später auf der Bühne im Westfalenpark von Dortmund – ein weiterer Sommerabend voller Magie! Seine schon etwas ältere Autobiografie ist ein Muss für alle, die tiefer in Bill Brufords Denkweisen und Erlebnisse als Bandleader und Sideman eindringen wollen. Und sie ist en passant sehr witzig – das bessere Wort wäre „sophisticated“! HIER noch ein Auftritt von Bill Bruford als Interviewgast, der einen weiten Bogen schlägt – timewise, soundwise!
“Stargazing with Gregory“
„If there is a middle ground between Cluster & Eno, Terry Riley’s Shri Camel, and Yo La Tengo’s There’s a Riot Going On, it’s somewhere nearby. Lofty comparisons aside, Gregory Uhlmann’s Extra Stars seems to look beyond reference or imitation. Even the album’s title indicates as much — inspired by a trip to California’s Ancient Bristlecone Pine Forest, where the reality of the night sky’s starry expanse stretches beyond the boundaries of belief.“ (International Anthem HQ)
- Sunday, February 15, 2026
- 5:00 PM 6:00 PM
- Angels PointAngels Point Road, Los Angeles, CA
Die Cd / Lp erscheint am 6. März. Icn habe sie heute gehört, und der launige Vergleich trifft schon zu: stargazers‘ paradise – surreal, fragile, illuminating! Scheint irgendwie Klanghorizonte-Stoff zu sein… (m.e.)
Spätzünder
Für mich erstmal eine Überraschung, dass sich Gillian Welch und David Rawlings auf ihren anstehenden Live-Auftritten der Musik von Grateful Dead zuwenden. Ich habe einige Alben dieses Paars, das irgendwo zwischen zeitlosem Folk und neorealistscher Countrymusik eine einsame Klasse darstellt. Was aber Grateful Dead angeht, habe ich mir in ganz jungen Jahren nur ein Album von ihnen zugelegt: „Blues for Allah“. Ich war beeindruckt, aber nicht so, dass ich die Wege dieser Mythenumwobenen weiter verfolgt hätte. Die Neuauflage von „Blues For Allah“ auf Vinyl (Rhino) packte mich dann vor Wochen einmal mehr, ohne sanfte Blicke in den Rückspiegel der Zeit. Also erlaubte ich es mir, zwei Alben der „Grossartigen Toten“ zu besorgen, die mich nach einigem Stöbern besonders anlockten: einmal „Terrapin Station“, ein feines Album, das einen Hauch von „Abbey Road“ in die USA transportiert: Streichinstrumente, grosser Raum, opulente Sphären und feinsinnge Songgespinste! Das alles serviert mit den „deep americana roots“ der Gruppe.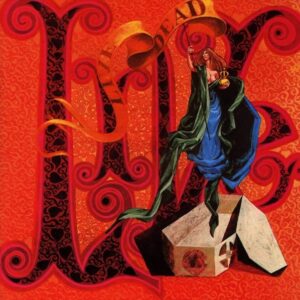
Aber das war nur ein gelungenes Vorspiel für die Wucht und Wirkung, die „Live Dead“ gestern Abend auf mich ausübte. Ich kann mir gut vorstellen, wie dieses ausufernde, wilde, hypnotische Live-Album 1969 auf die Hippie- und Underground-Kultur gewirkt hat, und beneide Lajla, dass sie die Jungs und Mädels einst in San Francisco oder wo auch immer livehaftig erlebt hat: ich staune! Und ich sehe keinen Grund, es nicht an die Seite zu stellen des mir seit 1971 bestens bekannten, immer wieder gehörten, innig geliebten „Live At Fillmore East“ der Allman Brothers. Und mittlerweile kann ich mir gut vorstellen, wie das Duo Gillian / Welche die Melodien und Essenzen der Grateful Dead filtern und verwandeln! Es wird Abende geben, da werde ich das Kerzenlicht anzünden und sehr gerne, je nach Stimmungslage, eines dieser drei Alben aus dem Regal holen. Verdammt gute tiefe Musik. Räucherstäbchentauglich, wenn mir diese kleine „Regression im Dienste des Ichs“ erlaubt wird! (m.e.)
Im Vorübergehen notiert
Der Plan war, heute morgen um 7 Uhr an meinem liebsten einsamen Strand von Lanzarote rumzuliegen und zu schwimmen. Aber die angekündigten Temperaturen spielten nicht mit. Im Süden zu frisch, im Norden zu kalt. Eisberge vor Rügen, really? Die Alternative war, auf der Uwe-Düne in Kampen auf die Nordsee zu schauen mit Ralph Towners „Solstice“ im Walkman. By the way: wer erinnert sich noch an „The Sylt Loneliness Treatment“?! So reinigte ich den Pellett-Ofen, liess meine Mädels ausschlafen, ging Brötchen holen und die kleine Bergrunde. Im März dann!

Es ist Steve Tibbetts gewesen, der mir erstmals vor Jahren von Schallplatten erzählte, die in seiner Jugend wochenlang seinen Plattenspieler blockierten: „Dis“ von Jan Garbarek zählte dazu, Jefferson Airplanes „After Bathing at Baxters“, Cans „Tago Mago“. Jetzt, wo ich nur noch wenige Sendungen mache im Jahr, kehrt auch bei mit dieses Ritual bedingungslosen Wieder- und Wiederhören bestimmter Alben zurück. In der letzten Woche hörte ich songut wie nichts anderes als die neue Vinylfassung von „Oracle“ von Gary Peacock und Ralph Towner.
Jens hat schon recht, wenn er das karge Echo der Presselandschaft auf den Tod Towners bemerkt. Aber Der Spiegel betreubt seit Jahrzehnten konservativen Musikjournalismus, „Die Zeit“ hat nie einen würdigen Nachfolge für Konrad Heidkamp präsentiert, und nach dem Verschwinden von Karl Bruckmaiers „Musikseite“ ist auch die SZ im mediokren Zeitgeist angekommen: wenige Ausnahmen bestätigen die Regel, dass jedes neue Beyonce-Album einen Vierspalter verdient und jedes neue Freunschaftsbändchen der Taylor Swift-Gemeinde mehr Aufmerksamkeit erfährt als der Verlust visionärer Musiker jenseits des Mainstreams.
Ich suche noch ein konsensfähiges Konzert als Geburtstagsgeschenk, für das sich die Mädels so begeistern können wie ich. Nicht leicht: In Hamburg, da, wo Elke, Olaf, Norbert und ich Anouar Brahem erlebten im letzten Jahr, tritt 2026 Elvis Costello auf. Das Thema: seine frühen Songs! Retro kann aufregend sein bei diesem Elvis, denn man weiss nie: lässt er es krachen, oder serviert er ein Streichquartett? Aber 110 Euro für einen guten Sitzplatz und die weite Reise bedeuten ein dezentes No. Köln wäre noch okay gewesen.

Es ist ein paar Tage her, da bot ich auf dem Blog den „heiligen Gral“ von Herrn Roedelius zum Verkauf, nun meldete sich ein Interessent aus Passau, der mich auf 150 Euro runterhandeln wollte für meine limitierte „Forster Schatztruhe“ aus den 1970er Jahren. Ich lehnte freundlich ab. So lange Autofahrten ins tiefe Bayern sind schon ein paar Jahre her. Einmal sauste ich mit meinem Toyota nach Garmisch-Patenkirchen, um mir mittels einer Seilbahnfahrt zur Zugspitze die Eustach‘sche Röhre zu öffnen (voller Erfolg!), einmal besuchte ich Manfred Eicher im Hauptquartier, für eine längere Sendung über Tigran Hamasyans ECM-Album „Atmosphères“, einmal trafen sich die „Pioniere“ der kognitiven Verhaltenstherapie für Suchterkrankungen in Furth. i. W. vierzig Jahre später (auf der 8 Stunden Fahrt lief unentwegt Robert Fripps „Music For Quiet Moments“) – drei ganz spezielle „road movies“!