Ein paar gute Gründe, Jan Reetzes Portrait über Joe Meek zu lesen
„Meek ist mit der Kompression immer schon bei der Aufnahme in die Vollen gegangen. Deswegen gibt es in seinen Produktionen praktisch keine Pegelsprünge, alles ist gleich laut. Für die damaligen Hörer muss die Musik geradezu aus dem Lautsprecher gesprungen sein. Außerdem gingen durch das mehrfache Hin- und Her-Überspielen die Höhen ein bisschen verloren. Im Radio fiel das nicht auf, weil eh alle Pop-Programme über Mittelwellen liefen (die das alles sowieso nochmal komprimierten), die Kids hatten Kofferplattenspieler mit Lautsprecher im Deckel, und die Jukeboxen in den Kneipen waren auch nicht für Hifi-Sound bekannt. Für solche Wiedergabe hat Meek seine Sachen produziert. Die guten Meek-CDs (ich habe am Ende ja ein paar aufgeführt) sind zumeist nur ein bisschen klangrestauriert und geben zumindest einen Eindruck dessen.“ (aus einer Email von Jan R.)

Mein Wissen über den Produzenten Joe Meek (1929-1967) war nur bruchstückhaft, bis ich dieses Buch in die Hände bekam. Ich machte mich vor der Lektüre kein bisschen schlau, ausser, dass ich mir seinen Welthit „Telstar“ anhörte. Ich wollte mich überraschen und auf eine Zeitreise mitnehmen lassen. Und ich wurde überrascht.Das Cover strahlt den Charme allerfeinster „pulp fiction“ aus: wie ein alter Schmöker – ich witterte eine leicht gruselige Geschichte, voller Zwielicht, Spannung und geisterhafter Gestalten. Tatsächlich könnte man aus der von Jan Reetze servierten Lebensgeschichte eines dezent schwierigen Charakters eine richtig gute Netflixserie machen, oder einen historischen Roman mit und ohne Tiefgang, in dem es nur so wimmelt von Geisterjägern und Visionären, dreisten wie seriösen Geschäftsleuten, Stars und Sternchen.
Da es aber nun mal ein Sachbuch ist, ausserordentlich klug in Szene gesetzt, in keiner Weise auf sensationelle Enthüllungen schielend, erfahren wir en passant erstaunliche Dinge über die Geschichte der sog. Popularmusik, in welcher früher Rock’n’Roll und die weite Welt des Schlagers noch den Ton angaben, als auch über das Spannungsfeld der Sechziger Jahre, das, bei allen Aufbruchsstimmungen und Grenzerweiterungen, auch jede Menge Repressionen und Engstirnigkeiten bereithielt: so war der Protagonist als Homosexueller ohnehin in eine Aussenseiterrolle gedrängt.
Joe Meek gehörte zu dem Typus seiner Zunft, der die aufgenommene Musik seiner Klientel nicht realistisch abbilden, sondern mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln fantasievoll erweitern wollte. Das Publikum sollte eingefangen werden von unerhörten Sounds. Und in dieser Hinsicht war Meek, lange vor dem Einsatz von Synthesizern, absolut innovativ – vom Bau spezieller Gerätschaften bis zur Herrichtung eines Tonstudios.

In grosser Ruhe folgt Jan Reetze den einzelnen Stationen von Joe Meeks Vita, seinem Kampf um Anerkennung und Unabhängigkeit, seiner Suche nach passenden Aufnahmeorten und Künstlern mit grossem Potential, seinen kreativen Visionen sowie den zahlreich vorhandenen „inneren Dämonen“. Konflike entstehen fortlaufend: von früh an mit einer ungesunden Portion Misstrauen ausgestattet, ist er alles andere als geschickt im Umgang mit seinen Zeitgenossen.
Ein Leben wird umso glaubwürdiger erzählt, je sorgfältiger die Spuren gesichert werden. Ohne „Küchenpsychologie“, aber auch ohne tiefenpsychologischen Fachjargon, entsteht vor den Augen des Lesers gerade deshalb ein so überzeugendes Bild dieser Figur, weil der Autor trennscharf zwischen Fakten, Spekulationen und Gerüchten zu unterscheiden weiss, aber nicht wie ein Besserwisser, vielmehr mit gebotener Umsicht und gelegentlich leisem Humor! Man spürt bein Lesen, dass dem Autor die geradezu detektivische Recherche grosse Freude bereitet hat.
Das Buch kommt wie ein raffiniert angelegtes Puzzle daher, dessen einzelne, durchweg erhellende Elemente die vielen kurzen Kapitel sind, die jede Form von Verzettelung verhindern, und all die „Bausteine“ dieses letztlich tragisch endenden Lebens gleichberechtigt nebeneinander stehen lassen, ob es um Meeks Studioexperimente geht, Visionen vom Leben auf anderen Planeten, die zum Ende hin vermehrt angestrebte Kontaktaufnahme mit berühmten Toten, den gelebten Alltag, das schwule Milieu, gerichtliche Auseinandersetzungen, diverse Abwärtsspiralen.
Eine rundweg fesselnde Lesefreude also, die wechselweise Aha-Erlebnisse und Gänsehaut beschert – und ohne medienpädagogischen Zeigefinger eine kleine Lektion darin erteilt, was die sehr guten Biografien von den nicht so guten trennt: den geduldigen Blick für die Zwischenräume und Grauzonen!
Daylight, Daylight
„Laughter in shadows
Where you used to stand
With all of us around
Particles bright
In my letter of light
Scattered the sea
The fools, they agree
It‘s all we knowIch habe mich oft zu einer Musik hingezogen gefühlt, in der vermeintlich nichts passiert, und doch so viel. Als ich das Album erstmals hörte, um das es hier geht, war ich auf Anhieb verblüfft. Zu wenig war ich mit den Alben dieses Singer / Songwriters vertraut, um zu beurteilen, ob sich diese Art von Liedern schon früher bei ihm angedeutet hatten: nichts Zupackendes, Riff-Betontes , eher ein durchgängig verhaltendes, impressionistisches Flair, dem sich die ruhige, nie verschwommene Stimme bestens zugesellt. Orchestrale Klangfarben kommen ins Spiel, aber dermassen subtil und dezent, dass aufmerksames Lauschen die einzige Chance ist, dieser Musik nahezukommen. Als Vergleiche werden in Besprechungen hier und da Bert Jansch, Talk Talk und John Martyn ins Feld geführt, ich würde noch M. Ward nennen, was den leichten Rauch in der Stimme angeht – und wenn diesem wunderbaren Liederzyklus ein Thema zueigen ist, dann „traveling“. Auf jeden Fall wird es die Nummer 8 meiner Jahresendliste sein. Beim Hören wird man, wenn man nicht ratzfatz das Interesse verliert, sanft in das Gewebe dieser Songs hineingezogen, und haben sich die Ohren einmal auf die diskrete Art der Soundmalerei eingelassen, sind es die kleinen Ereignisse im Panorama, die unsere Aufmerksamkeit erregen. Die lyrics leisten das ihre, um uns auf all diesen Reisen und Momentaufnahmen zu begleiten. Steve Gunn hat mit „Daylight, Daylight“ ein fabelhaftes Album fabriziert, u.a. mit James Elkington und einer gewissen Macie Stewart an seiner Seite, die auch Alabaster DePlume auf seiner letzten Tour begleitete. „Bevor der Film dir erklärt, was er bedeutet, ist die Geschichte völlig falsch und wird es vielleicht auch immer bleiben“, singt Gunn an einer Stelle und weist damit diskret auf die Sinnlosigkeit hin, nach Anzeichen für einen großen Plan zu suchen, wenn doch die unmittelbare Gegenwart alles ist, was wir haben. HIER der Auftakt! „Now come along, keep on / Distance is growing / We’re nearly there…“ (einen Satz aus Sharon O‘Connors „Hin-und-weg“ Uncut review habe ich hier einfliessen lassen, aber nicht diesen hier: „This is music that slowly pitches around on a rolling sea, or swoops in hazy air.“)
Afterglow: „Toward the end of the recording process, he revisited that song he’d recorded late at night in his kitchen. It reminded him somehow of the famous story about Neil Young sitting by a fireplace and recording “Will to Love” in a single take in 1976. He called the song “Daylight” at first, until Elkington suggested doubling the title. “And I was like, ‘That’s the name of the record,’” Gunn says. “Rebirth, beginning again, letting some daylight come into the darkness. It all just clicked.”“
Die Zauberertruppe, die sich als Klaviertrio ausgibt, kommt heute in den Musikbunker nach Aachen!
Und Olaf und ich sitzen in der ersten, zweiten oder dritten Reihe.
Wenn Olaf pünktlich anrauscht.
Tatsächlich ist das Konzert bestuhlt.
Magiern soll man sowieso im Sitzen lauschen.
Weeks and weeks ago, i listened to one of the four tracks of their new triple cd in Paris, on a warm sunny afternoon. And of course i chose WARM RUNNING SUNLIGHT knowing I would definitely be the first human to listen to it in my favourite Paris Park, Le jardin du Luxembourg. What a joyful experience lying on the green grass with closed eyes (mostly), and a peaceful atmosphere all around.
Kurzer Nachtrag, einen Tag später: pure Magie in zwei stets fesselnden „Tranceinduktionen“, Ein Rausch der Obertöne. Grossartiger Sound Im Musikbunker. Obwohl Olaf und ich ganz vorne sassen, in der dritten Reihe bühnennah, waren meine Augen, wie es sich bei Klangreisen dieser Art gehört, meist geschlossen. Das erste lange Stück schien mit eine Version eines fantastisch ausufernden Tracks ihren neuen Triple-Cd DISQUIET zu sein.
In meinen letzten Klanghorizonten im DLF (mit den Necks, leicht nachzuhören ein paar Zeilen höher, mit einem Klick auf „Gute Reise“) bezeichnete ich Aachen als „Diaspora, was experimentelle Musik betrifft“. Der Musikbunker ist da tatsächlich nahezu der einzige Hoffnungsträger und bescherte uns Grenzlandbewohnern bereits, über die Jahre verteilt, Lambchop, Howe Gelb u.a.
Der dunkel ausgeleuchtete Raum war rappelvoll, mit vielen „Zugereisten“. Ein paar musikalische „Wahlverwandte“ vor und zwischen den beide Sets kennengelernt, Uwe & Anne aus Düsseldorf (Themen unseres small talks: das tolle Stück, das Underworld einst mit den Necks veranstaltete, Hauschka alias Volker Bertelmann, der so angenehm geerdet geblieben ist über die Jahre etc.) oder Bernhard aus Limburg. Letzterer ist ein Storyteller par excellence (was nicht zuletzt Musikerlebnisse betrifft). Anne kommt wie Steve Tibbetts aus dem Amerikanischen Mittelwesten. Es war überhaupt – Olaf wird mir beipflichten – ein spannendes Publikum. Die drei Zauberer schauten zwar konstant „von ernst bis versonnen“ , waren aber offensichtlich sehr inspiriert vom ganzen Ambiente.
By the way, der nächste Zauberer kommt in den Musikbunker am 23. November: Nitai Hershkovits. Solo-Piano. Seine LP / CD „Call On The Old Wise“ ist einfach nur grossartig. Und produced by Manfred Eicher. Look and listen HERE!
„Something stranger“ – the ongoing flow of Eno & Wolfe on „Liminal“
Ein überschaubares Arsenal von Instrumenten, im wesentlichen Synthesizer und Gitarre. Zwei prägende Instrumente der Rockhistorie – und nichts ist offenbar zuende erzählt. Wenn etwas aus der Musik des Duos völlig verschwunden ist, dann Tempo, Action, und Aufruhr. Alles, auch der Gesang, macht sich immense Langsamkeit zueigen. Die Ruhe der Ausführung behindert allerdings nicht das, wiederum zu den Zutaten und Mythen der Rockgeschichte zählende, „berauschende Hören“.Aber eins nach dem andern: nach ihrem Liederzyklus „Luminal“, einer Art „electric country dream music“, in der das Private und Politische nah beieinander sind in unseren dunklen Zeiten; nach der rein instrumentalen Grosskomposition „Lateral“, mit ihren subtil unheimlichen Prairieräumen, liegt nun der dritte Streich von Brian Eno und Beatie Wolfe vor. „Liminal“ ist keine harmlose Restesammlung, vielmehr eine spannende Abfolge von immens reichhaltigen „instrumentals“, Songs und Songartigem. Jede der elf Kompositionen enthüllt eine andere Sphäre: mal Lamento, mal urzeitliche Fantasie, mal das in einem Waschsalon angesiedelte, wohl wortreichste Trennungsstück der jüngeren Pophistorie! „Liminal“ überrascht an allen Ecken und Enden.
Obwohl wir hier ein ums andere Mal mit Staub, Endlichkeit, Verfall und Nacht konfrontiert werden, in Versen, die manches Rätsel aufgeben und hier und da als neue Koans für Zen-Schüler dienen könnten, ist es eine seltsam erhebende Erfahrung, diese unbekannten Orte aufzusuchen. Die Gitarre, folkig, meditativ, ist nicht so weit von den alten Lagerfeuern entfernt: eine reine stille Freude, mehr als ein Quantum Trost in den dunklen Räumen ringsum.
Und was für eine seltsame und nahtlose Balance zwischen den Momenten am Abgrund, und beinah warmherzigen Abenteuern mit ozeanischen „vibes“ dazwischen! Die einzige Möglichkeit, aus dem Staunen herauszukommen (wenn man einmal Feuer gefangen hat für diese elementare Klangwelt aus Gitarre und Elektronik und Stimme und wenig mehr), besteht darin, sich der Versuchung zu entziehen, das Album wieder und wieder anzuhören! Aber warum sollte man!?
(Michael Engelbrecht, Deutschlandfunk)

Im folgenden erzählt Beatie Wolfe, gewohnt markant, etwas über ihre gemeinsame Arbeitsweise, und über den Song „Shudder Like Crows“, der ein perfektes, ergreifendes Finale für „Liminal“ abgibt, ein Werk, das alles andere als eine Resteverwertung ist, und in 11 Kompositionen elfmal die Landschaft verwandelt, den Ton, die Stimmung, die Gefühle. Ein Kreis schliesst sich mit „Liminal“ zu dem vor 50 Jahren erschienen Album „Another Green World“, auf dem Eno erstmals Ambient und Song mischte.
Mitten im Leserausch

Dies ist keine Romanbesprechung. Denn ich bin erst auf Seite 257. Und der Kriminalroman hat 571 Seiten. Federico Axat wurde 1975 in Buenos Aires geboren, wo er auch heute lebt. Das ist das erste Buch, das ich von ihm lese. Keine Spoilerei, keine Sorge. Die Geschichte beginnt mit einer enorm erfolgreichen Journalistin (zwei Emmys für investigative Fernsehbeiträge – na ja, okay!), die sich aus ihrem Beruf zurückzieht, und es dann doch nicht sein lassen kann. So weit, so bekannt. Eine Jugendliche ist verschwunden, man spricht von Suizid, aber daran bestehen gehörige Zweifel. Okay, das ist erstmal klassisches Krimi-Terrain.
Aber dann passiert mir dieser „switch“, dass ich plötzlich in der Story drin war. Axat hat einen angenehm intelligenten, unprätentiösen Schreibstil mit einer Prise Humor und der Fähigkeit, seine Figuren ernst zu nehmen. Das ganze Feld vibriert mit dem Zauberwort „coming of age“. Die junge Clique, die sich über Musik und Freundschaft findet, droht zu zerreissen, als ein Drama viral geht. Eine Protagonistin ist die nur musikalisch frühreife Janice, die nicht zufällig zu ihrem Namen gekommen ist und in Joplins Album „Pearl“ viel mehr von sich findet als in den keimfrei geschliffenen Pop-und-Country-Preziosen einer Taylor Swift. „I pulled my harpoon out of my dirty red bandana / I’s playin‘ soft while Bobby sang the blues / Windshield wipers slappin‘ time…“ Wie Musik als Bindemittel einer kleinen, halbverschworenen Gruppe von Teenagern fungiert, das hat was!
Dann das Ende all dieser Träume ewiger Verbundenheiten, das Ende der Jugend nah: ich fühle mich hier und da angenehm erinnert an meinen Lieblingsfilm „Absolute Giganten“. Ich mag es, wie der Autor aus manch unscheinbarer Figur vielschichtige Momente hervorzaubert. Der Aufbau der Spannungskurven funktioniert auch dank zweier faszinierend in Szene gesetzter Zeitebenen, angesiedelt vor und nach dem Verschwinden der hochintelligenten Sophia (hochintelligent, Zentrum der Clique, der diversen Handlungsebenen, Schlüsselfigur mit erstaunlich früh gebildeter Menschenkenntnis und detektivischem Talent – sie heisst auch noch Holmes, fällt mir echt erst jetzt auf).
Und so bin ich jetzt mittendrin, auf Seite 257, hoffe, dass Sophia keinen schlimmen Scheiss gebaut hat und noch lebt – und schreibe diese Zeilen im Wartezimmer einer ungemein sympathischen, extrem gutaussehenden Augenärztin. Zumindest in diesem autobiografischen Fall werde ich alle Rätsel auflösen (ich bin vielleicht viermal in meinem Leben bei Augenärzten gewesen, zweimal davon mit sechs oder sieben Jahren): normaler Augeninnendruck, mit Brille komme ich links zumindest auf 100 Prozent, Anfang eines Grauen Stars (muss nicht operiert werden), kein Grüner Star. So weit, so gut, so altersgerecht! Jetzt aber ratzfatz zurück in mein erstklassiges Leseabenteuer, dem wahrscheinlich besten Psychothriller seit „Der Gott des Waldes“ von Liz Moore! Ein Fall nicht nur für Sylvia aus meiner Klartraumgruppe!
“the lateral and luminal surrender experience“
In regards to „Luminal“, surely one the most beautiful albums of 2025, there is only one reason I don‘t come up with the minor quibble that Brian Eno isn‘t doing the lead vocals, and that is the voice of Beatie Wolfe! (Michael Engelbrecht, Deutschlandfunk)
Warum ich noch nicht über das Büchlein „What Art Does“ von Brian Eno und Bette A. geschrieben habe, ist rasch erzählt: ich bin allzu vertraut mit all den Gedanken über Kunst, Feelings, Surrender, Play, etc. die Brian in dieser „unfinished theory“ ausbreitet, nach seinem Anspruch so verständlich, dass es auch nicht auf den Kopf gefallene Teenager verstehen können, und herrlich bunt bebildert ist es zudem! Wäre ich Kunstlehrer, wäre das Stammlektüre in meinen Klassen. Ab und zu schmökere ich mit Vergnügen in dem Bändchen. Viel lieber aber begegne ich der Kunst ohne Metaebene, lasse die Feelings durch mich hindurch strömen und rauschen, wenn ich „Luminal“ oder „Lateral“ auflege, Brian Enos famose neuen Alben mit Beatie Wolfe, und erlebe da, ungefiltert, Surrender, Play, etc., in allen Schattierungen zwischen dem Unerhörten und dem Unheimlichen, zwischen dem Fest und den Erschütterungen des Lebens. Denn all das dringt hier durch, und viel zu fesselnd, in diesen Wochen, um kluge Worte darüber verlieren zu wollen. Das Erlebnis der Tiefe spielt sich stets im Zwischenraum von Sender und Empfänger ab, und hier, bei den elf Songs von „Luminal“ etwa, bringe ich es schlicht und ergreifend so auf den Punkt, dass mein mutmassliches Songalbum des Jahres 2025 mich so tief erwischt, berührt, umfängt, umgarnt, verführt, auf gut deutsch „haunted“, dass es seinen Platz findet neben meinen Songalben der letzten beiden Jahre von Beth Gibbons und P.J. Harvey. „Luminal“ ist ein Album, das Tore öffnet, tief taucht und, mich jedenfalls. einfach mitreißt!

Why I haven’t yet written about the little book ‘What Art Does’ by Brian Eno and Bette A. is easy to explain: I am – after so many interviews and lectures – all too familiar with all the thoughts about art, feelings, surrender, play, etc. that Brian expounds in this ‘unfinished theory’, which he claims is so comprehensible that even teenagers who haven’t fallen on their heads can understand it, and it is also wonderfully colourfully illustrated! If I were an art teacher, this would be standard reading in my classes. I enjoy browsing through the book from time to time. But I much prefer to encounter art without a meta-level, to let the feelings flow and rush through me when I put on ‘Luminal’ or ‘Lateral’, Brian Eno’s famous new albums with Beatie Wolfe, and experience there, unfiltered, Surrender, Play, etc., in all shades between the unheard and the uncanny, between the celebration and the darker waves of life. Because all of this comes through here, and far too captivating, to want to lose clever words about it. In the moment. The experience of the profundity of art always takes place in the space between sender and receiver, and here, with the eleven songs of ‘Luminal’, for example, I simply get to the heart of the matter in such a way that my presumed song album of the year 2025 catches me so deeply, touches, embraces, ensnares, seduces, haunts, that it finds its place alongside my song albums of the last two years by Beth Gibbons and P.J. Harvey. „Luminal“ is an album that opens gates, dives deep, and simply elevates! At least that happens to me!„Grosses Leeres Land“, und andere Traummusik

Es ist noch unklar, ob ich meine kommenden Klanghorizonte völlig ohne Interviewausschnitte, als eine Art Essay aufziehe, oder mit drei Interviewpartnern, die Angel Bat Dawid, Beatie Wolfe und Brian Eno wären. Ein kontrastreicheres Gespann lässt sich kaum vorstellen: Die aus ehrwürdigen Free Jazz Zirkeln Chicagos entstammende Angel mit all ihren „african roots“ und der Tendenz, jeden Auftritt in eine wilde Perfromance zu verwandeln, sowie der gewitzte „spirit“ von Beatie und Brian, das hätte was! Ohne Interviews würde – HIER! – eine alternative Playlist aktiv!
Heute Nacht träumte ich, dass Brian bei mir in einem Frankfurter Hotel zu Gast war. Ein offensichtlicher Tagesrest, denn ich beschloss, am kommenden Montag Brian und Beatie ggf. ein paar Fragen zu senden (über DGG / Verve). Nicht so leicht, mich und ohn da ei zu überraschen, zu gut kenne ich mich in Brians Gedankenwelt aus. Und so sassen wir in meinem sehr geräumigen Hotelzimmer, und ich war ein wenig ratlos. Brian hatte mir als Geschenk leuchtende alte Alben unter anderem von David Darling in Form kleiner Kristalle mitgebracht, die ihre Klänge nur preisgaben, wenn man sie in Licht tauchte. Trotz dieses Highlights verlief die Begegnung etwas schleppend.
NEW GHOSTS OF HIGHWAY 20
Nach dem Erwachen ging mir die Musik von „Lateral“ durch die Sinne. Ich hatte am Vortag der einstündigen Instrumentalkomposition gelauscht, nur Beatie an der Gitarre und Brian an den „synths“. „Lateral“ besteht aus acht Teilen „Big Empty Country“. Nüchtern gesagt: wie bei Discreet Music, Neroli, Lux, Thursday Afternoon oder Reflection (HIER mein alter „Manatext“ (oder sollte ich „Metatext“ sagen?) zu dem Album), passiert (scheinbar) nicht viel in diesen sechzig Minuten, aber das, was passiert, kann endlos faszinieren, zum Träumen einladen, immersiv sein, inspirierend, Vordergrund, Hintergrund, Mittelgrund. So umfangreich Brians Katalog der Ambient Music ist, er öffnet mit jedem dieser Album eine andere Soundwelt.
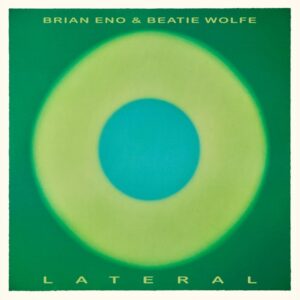
Weniger nüchtern formuliert, und nicht ganz in eigenen Worten: „Big Empty Country: was für ein Trip! Die meisten Reisen führen über eine gewisse Distanz, um ans Ziel zu gelangen, doch nur wenige packen den Ort, an dem man sich befindet, mit solch komplexer, unverschämter Herrlichkeit aus, dass man keinen einzigen Schritt tun muss, um ans Ende des Universums und zurück zu reisen.“
Gönnen Sie sich nun erstmal einen tiefen Atemzug! (eine kurze Pause)
Parallel erscheint am 6. Juni die nicht weniger fesselnde „Country Dream Music“ von „Luminal“ des Duos, mit den Gesängen von Beatie, den „background vocals“ von Brian, sowie allerlei Instrumenten. Wundersam tief und luftig!
WIDE OPEN SPACES
Eins noch: bei dem David Darling-„Kristall“ handelte es sich um „Cello“ mit dem Himmelblau aus einem Godardfilm. Damals, früh in den Neunzigern schickte ich Brian diese ECM-Produktion von Manfred Eicher, und er war begeistert!
Wie auch Tyran Grillo, der zu Cello schrieb: „…one of the most stunning albums ever to be released on ECM in any genre. Its fluid paths feel like home. Darling plows the improvisatory depths of his soul, given free rein in the studio to paint the negative spaces in between those clouds on the album’s cover, ever deeper, ever truer to the core of something alive. Most journeys might take you across some distance to get you to where you’re going, yet few will actually unpack where you are standing with such complex, unabashed glory that one need not take a single step to travel to the end of the universe and back. Cello is one such journey.“
Appendix:
ORANGE JUICE FOR THE EARS: BEATIE AND BRIAN (HERE!)
PLAY ON: ANGEL BAT DAWID IN ACTION (HERE!)in-depth reviews of Lateral (Big Empty Country) and Luminal will be posted at the end of May, in German and English.
Köln 75
Ich war eine halbe Stunde vor Kinoeinlass in der Bar des Apollo, und plötzlich strömten all die alten Menschen aus Kino 1. Mit und ohne Rolator, hustend, gebückter Gang, ein paar Rüstige bestimmt auch dabei, zwischen elegant und zottelig, ich gehöre ja nun auch zur Seniorengruppe, und das so geballt zu sehen, liess mich noch mal extra in dem Alter ankommen, in dem ich jetzt bin. Denn die kamen alle aus dem Dylan-Film, einige sichtlich bewegt. Und das war ich auch, als ich aus KÖLN 75 kam, zwei Stunden später.
Geschickt vermeidet es der Regisseur, in einem Film mit tollen Einfällen, exzellentem Drive, glaubwürdigen Zeitkolorit, grossartigem Schnitt, auch nur einen Ton aus THE KÖLN CONCERT zu servieren. Da wurde aus der Not, es nicht zu dürfen, eine Tugend gemacht. Wie er das anstellt, mit ganz anderer Musik aus jener Zeit – chapeau! Wir sind in Köln, und da bekommen wir auch das wilde Leben der jungen Vera zwischen Jazz und Psychedelik geliefert, incl. Can und Floh De Cologne. Und ein Ensemble, das spürbar grosse Lust hat, diese alte, verrückte, und weitgehend sehr wahre Geschichte zu erzählen.
Aber leider, leider: die Abwesenheit von Jarretts Spiel hätte konsequent durchgezogen werden müssen. Wenn dann nämlich in Lausanne ein „Jarrett-Imitator“ in die Tasten langt, wird die orginale Musik zum eigenen Klischee heruntergebrochen – und das ist doch überhaupt nicht nötig, in einem Film, der sich so mit allen Tricks zwischen Zeitreise, Drama und komödiantischem Überschwang bewegt. Auch in der wunderbar in Szene gesetzten Nachtfahrt von Lausanne nach Köln (Manfred Eicher ist schon gut getroffen!) klingt es verdächtig nach einem Nocturno a la Jarrett, aber natürlich nicht von Jarrett – die Szene hätte mit klavierbefreiter Melancholie gewonnen (zum Beispiel mit Brian Enos „Sparrowfall“ oder einem Stück aus Ralph Towners „Diary“).
KÖLN 75 ist famoses Kino, auch ein zweites Sehen wert – und wie dieser Genre-Mix Jazzhistorie en passant vorführt, allemal ein Extralob wert. Auf dem Weg in die City und zurück lief die lange erste Improvisation vom Original, in voller Länge in meinem Auto! Eine Woche vor jenem Ereignis, waren Keith und Manfred in Kronach bei „Rosato“ in der Aula eines Gymnasiums – diese herrliche Story hat uns Hans Dieter Klinger schon mal zum Besten gegeben. Das Hotel, in dem die beiden übernachteten, hiess „Sonne“. Sieben Tage später verweilte das Duo nahe der Alten Oper im „Hotel Engelbrecht“. Der Rest ist Geschichte! Und die von Rosato ist HIER nochmal nachzulesen!
All die freien Räume (ECM 1187)

Nur zwei Alben veröffentlichte der Pianist und Synthesizerspieler Rainer Brüninghaus als Bandleader, „Freigeweht“ (1981) und „Continuum“ (1984), und sie haben über all die Jahrzehnte hinweg nichts an Ausstrahlung verloren: „Freigeweht“ liegt nun in der ECM-Vinylserie „Luminessence“ mit tadelloser Pressung und Gatefoldcover vor, ergänzt von einem klugen Essay, der dieses kleine Meisterstück im Rückblick einordnet und verschiedene Facetten erhellt, etwa Spuren von Minimalismus in diesem sogenannten „kammermusikalischen Jazz“. Aber was heisst schon „Kammermusik“ bei so vielen sperrangelweit geöffneten Aussichten!? Vielen wird es so ergehen, dass sie sich diese lyrisch-aufregende Musik wieder und wieder anhören, weniger, um sich wohligen Erinnerungen zu überlassen, oder analytisch den Geistern eines anderen Zeit nachzuspüren (das wären allenfalls Begleiterscheinungen): alle Beteiligten sind schlichtweg „on fire“, von dem Komponisten selbst, der das Understatement jedem virtuosen Fingerzeig vorzieht, über den Meistertrompeter und die Schlagzeuglegende, bis hin zur „wild card“ des Oboisten und Englisch-Horn-Spielers! Für eine jüngere Generation von Hörern mag dieses Werk eine Eintrittskarte sein, andere aussergewöhnliche Alben des ECM-Katalogs kennenzulernen, in denen Brüninghaus als Sideman seine diskret-vielschichtige Magie verströmt, etwa Eberhard Webers „The Colours Of Chloe“, „Yellow Fields“ und „The Following Morning“, oder Jan Garbareks „I Took Up The Runes“. „Freigeweht“ reiht sich da, ohne grosses Aufheben, nahtlos ein: einsame Klasse in bester Gesellschaft!
(Die Wiederveröffentlichung erscheint am 24. Februar. Musik: 10 / Klangqualität: 10 / Sequenz der Stücke: 10 / Fertigung und Gestaltung: 10 / Repertoirewert: 10)
Das schönste Buch des Jahres 2025
Vor wenigen Wochen versammelten sich renommierte Journalisten und verrieten dem Publikum der SZ ihren Favoriten unter den Erzählwerken. Elke Heidenreich begann ihren kleinen Text mal gleich mit dem Auftakt „Das schönste Buch des Jahres 2024…“ und sang eine präzise Lobeshynmne auf Samantha Harveys „Umlaufbahnen“. Ein Buch das es locker in meine Top 10 gebracht hat, und, ehrlich gesagt, meist sind die Tips von Frau Heidenreich für mich insofern aufschlussreich, weil ich ihnen besser nicht Folge leiste. Ist ja alles auch sehr relativ.
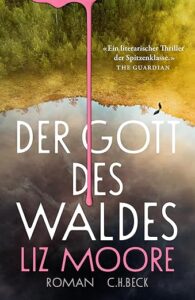
Über das Cover kann man natürlich streiten. Aber, ähem, ich habe gerade, vielleicht, also, ich sage „vielleicht“, das schönste Buch des Jahres 2025 gelesen. Es hat knapp 600 Seiten, ich habe es über weite Strecken „verschlungen“, einmal abends 110 Seiten am Stück gelesen, was nah an meinen persönlichen Leserekord kommt. Es pendelt raffiniert zwischen verschiedenen Zeiten und spielt sich zu zwei Dritteln in einer Gegenwart ab, die 1975 Gegenwart war. In einem Feriencamp. Die Boys und Girls, die da auftauchen (und Liz Moore versteht es, ihnen wahres Leben und Lebendigkeit einzuhauchen), sind also in dem Alter, in dem ich war, als ich im Würzburg anfing Psychologie zu studieren. My Generation. Sozusagen. Ich werde jetzt aber nicht gleich die Who und „Live at Leeds“ auflegen. Und diese Identifikationsebene hat auch nicht meine Urteilskraft getrübt.Hammerbuch. Familienroman (über mehrere Generationen), eigentlich gar nicht mein Ding, aber egal. Ein Kriminalroman mit Tiefgang. Kein Mysteryroman, wie der Titel suggerieren könnte. „Der Gott des Waldes“ ist eine Geschichte vornehmlich weiblicher Befreiungsakte, und deren Scheitern als Option (was nun auch nicht mein Thema ist, weil das oberflächlich als „Frauenbuch“ abgetan werdem könnte). Ist es aber nicht, oder nur wieder so eine falsche Fährte – in einem Buch voller falscher Fährten. Zudem bekommt man gleich auch noch einen epischen Kurs in „Survivaltraining“ geliefert. „Wenn du dich verlaufen hast, setz dich hin. Und schrei laut.“ Und, das muss ich nun auch einräumen, ich war so drin in dem Buch, dass ich als auf das furiose Ende zulief, ein paar mal eine wirklich schaurige Gänsehaut erlebte, ehrlich. Auf keinen Fall den Klappentext lesen. Erscheint im Februar bei C.H. Beck. In meinen Top 10 wird es locker landen. Ein Pageturner mit langem Nachhall, versprochen! (Aber ich kann ja viel erzählen.) P.S. Ende März ist Liz Moore auf der LitCologne.