we‘ll meet twice in a lifetime (intro)
A little new series, maybe some flowworker or reader will add a chapter.
Es geht um ein psychoakustisches Experiment. Erinnere dich an ein Album, das du vor sehr langer Zeit gehört hast, und das vielgelobt wurde, in aller Ohren und Munde war oder von der Kritik mit viel Lob überschüttet wurde. Ob es nun einer deiner Favoriten war oder nicht: erinnere dich an eine solche Schallplatte, ob als Blogleser oder Flowworker, an die du mit hohen Erwartungen herangegeangen bist, und das dich dann, zu deiner eigenen Überraschung, völlig kalt gelassen hat. Du konntest nichts damit anfangen. UND NUN ENTSCHEIDEST DU DICH, ES NOCH EINMAL ZU HÖREN. WHAT WILL HAPPEN?

We all know records that are regarded as masterpieces or really great albums, or albums with overwhelmingly positive critics or generally beloved albums of artists we normally love or like very much at least, albums that, well, well, you or me don‘t like at all. You were competely disappointed.
And if that has happened, such an album only leaves distant memories. What happens when we give such a work a seconds chance after eternities?
Maybe I start this series with a deep listening review of an album that came out in 1978 and disappointed me on first and only listening. What will happen now? Love on second sight, or same old story! Or something in between. Wait and wonder! In my case it is Ralph Towner‘s BATIK on ECM Records.
I give you some more personal examples. One is Hounds Of Love by Kate Bush regarded as a classic, a highlight of her career, a masterpiece of the 1980‘s. Years ago I tried to give it a second chance – honestly, i stopped after the third song – I don‘t get it, i don‘t like it at all. On the other side I was and am a huge admirer of her famous first album, and her two last studio albums. Interesting.

A list of albums following my line of merciless disinterest on first meeting:
ABC: Lexicon Of Love
Heaven 17: Penthouse And Pavement
Lou Reed: The Raven
Ralph Towner / Jack DeJohnette / Eddie Gomez: Batik
Keith Jarrett: Bridge Of Light
Scritti Politti: Cupid & Psyche 85
Tomita: FirebirdWe‘ll meet twice.
Die verschwundenen Plattenläden

Eine
zu bittersüße Lektüre.
Wenn ich heutzutage
durch bestimmte Teile Londons
gehe, bin ich oft versucht,
mir Scheuklappen aufzusetzen,
da so viele scheinbar unauslöschliche
Säulen der Stadt verschwunden sind.
Ray’s Jazz Shop mit seinen Doppeltüren
und den exzentrischen Zeitungsausschnitten
mit „Jazz-Namen” an der Wand –
„Colonel Al Haig” – und den schmerzlich
vermissten Bob Glass und Ray Smith
hinter der Theke; Dobell’s hinter The Mousetrap;
Mole Jazz und
der verstorbene, großartige
Ed Dipple; die beiden Filialen
von Vinyl Experience;
Rhythm Records; Intoxica; Sounds That Swing;
der Rough Trade-Keller in Neal’s Yard…
alles längst verschwunden.
Dann plötzlich letztes Jahr
Harold Moores Records!
Ausgelöscht und ersetzt
durch eine Modeboutique.
Von den Londoner Buchhandlungen
will ich gar nicht erst anfangen.
Deshalb bin ich nach Schottland gezogen.
Alasdair Dickson
„Ein Taxi für Wim Wenders“
„Figures from a classified Israeli military intelligence database indicate five out of six Palestinians killed by Israeli forces in Gaza have been civilians, an extreme rate of slaughter rarely matched in recent decades of warfare.“ (The Guardian)
Schockiert und angewidert ist nicht nur die Schriftstellerin Arundhati Roy, als sie der Berlinale absagte, schockiert und angwidert waren auch viele andere, wie z. B. ich. Ob Wim Wenders den Brief persönlich liest, den ich ihm schreiben werde, auch über mein Kopfschütteln über seine aus meiner Sicht mutlose und sehr feige Reaktion – oder ob er vorher von seinem Sekretariat abgefangen wird – kann ich nicht einschätzen. Aber dieser Brief brennt mir auf den Nägeln und wird sich auch beziehen auf die Bewertung dieses „Skandals“ seitens der Journalisten Kathleen Hildebrand und David Steinitz in der Süddeutschen Zeitung vom 16. Februar 2026. Ob mein Brief als Rohrkrepierer endet oder nicht, ist mir egal – es tut einfach gut, ein paar Dinge aufzusdröseln, die stets in einen Topf geworfen werden und meistens die gleichen schematischen Reiz-Reaktions-Ketten, tagaus, tagein.
DIE SACHE MIT WIM UND UM WIM HERUM
In den 1970er und 1980er Jahren gehörte Wim Wenders nicht nur zu meinen „heroes“, und denen vieler aus meiner Generation. Von Musikern seiner Generation ganz zu schwiegen. Nicht zuletzt Eno und viele andere bewunderten viele seiner Filme, und sie erzählten die Stories mit ihrer Musik mit. Es war die Zeit, als das „Herz der Rockmusik“ noch „links schlug“. Wenn wir heute den Worten des Bundeskanzlers lauschen, gibt es Deutschland keine „linke Politik“ mehr. Werter Herr Merz, genau, die „Revolution“ scheint von rechts zu kommen, und wenn nun auch die legendären Filmemacher jener alten Zeit zur Entpolitisierung des Kinos ihr Scherflein beitragen, ist das umso trauriger. Eine Woche nach der Berlinale werde ich Wim Wenders den Brief zukommen lassen. Ich werde da alles Spruchhafte rauslassen. Vielleicht treffe ich einen Nerv.
Der Kerngedanke: Repräsentanen der israelischen Regierung werden vom Europäischen Gerichtshof genauo mit Klagen verfolgt wie die Hamas. Menschenrechtsverletzungen und Greueltaten! Die grauenhaften Verbrechen der Hamas, etwa am Tag des Gemetzels, wiegen genauso schwer wie die in der Folge erlebten, grauenhaften Tötungen Tausender und Tausender unschuldiger Palästinenser!
In den Reaktionen auf Arundhati Roys Absage an die Berlinale und den „offenen Brief“ vieler Kunstschaffender wird eine völlig unangemessene „Politikferne“ des Kinos propagiert, und all die Solidaritätsbekundungen auf einen falschen Dualismus pro-israelischer resp. pro-palästinensischer Haltungen runtergebrochen. Es geht, und das wird ein ums andere Mal in Abrede gestellt, wenn dem Kino das Politische abgesprochen wird, um die Opfer der Geschichte auf palästinensicher UND israelischer Seite. Und hierbei, lieber Wim Wenders, muss man sich keineswegs aus der Politik raushalten!
Als Elvis Costello einst den Song „Shipbuilding“ schrieb, einen Anti-Kriegssong, damals auf den Falkland-Krieg der Regierung Thatcher bezogen, hätte er ja, dieser tristen Logik folgend, dieses Lied, das Robert Wyatt sang, besser nicht geschrieben, denn Mr. Costello hielt sich ganz offensichtlich nicht aus der Politik raus. Es ist eben KEIN Antisemitismus, wenn man die israelischen Kriegsverbrechen anprangert.
So hat es mich entsetzt und angwidert, wie z.B. der UNO-Vorsitzende António Guterres angegangen wurde, als er, in der Zeit nach dem Massaker, als die Vergeltung einsetzte, von der Regierung Israels als Lügner und Antisemit hingestellt wurde, nur, weil er nicht die Augen verschloss vor den Verbrechen an der palästinensischen Bevölkerung. Von seiten der Regierung Trump und seines neu ins Leben gerufenen „Friedensrates“ muss man keine kritischen Äusserungen in Richtung Israel erwarten.
„TAXI TEHERAN“
Und es war keine Ausnahme, wenn in der Historie der Berlinale Filme gepriesen, gefeiert wurden, die unter schwierigen Umständen der politischen Zensur im eigenen Land entgingen. Und jetzt? UND JETZT, AUF EINMAL, DIESER TURNAROUND!? WEIL DER ZENTRALRAD DER JUDEN IN DEUTSCHLAND ANTISEMITISMUS WITTERT, WANN IMMER ISTAELISCHE VERBRECHEN AN DER MENSCHLICHKEIT THEMA WERDEN?!
Das sich Kunst, dass sich Kino aus der Politik raushalten solle, ist in diesen Tagen, und im Kontext dieses Festivals, wahrlich eine These, die, sorry, an Falschheit und Feigheit kaum zu überbieten ist.
Dieser Text enthält zwei Songs von Momoko Gill und Elvis Costello.Und – HIER – einen Artikel von Brian Eno aus dem September 2025, hier der letzte Absatz daraus:
„Maybe one day future leaders of western political parties will issue a similar mea culpa for their complicity in the brutal violence currently being inflicted on Palestinian families. It will be too late to save many tens of thousands of civilian victims of this war. But if there is a reckoning it might be, in part at least, because actors, artists, writers and musicians helped us to see Palestinians as human beings, as much deserving of respect and protection as their Israeli neighbours. As the Egyptian-Canadian writer Omar El Akkad says, one day everyone will have always been against this.“
Dieser Text geht innerhalb von sieben Tagen nach der Berlinale an die Wim Wenders-Stiftung, zusammen mit meinem Brief, der einen sehr entspannten Storyteller-Sound haben wird.
Die Mädchen und der Jazz

So sind unsere Mädchen: wie Jazz. Und so sind die Nächte, die mädchenklirrenden Nächte: wie Jazz: heiß und hektisch. Erregt.
Bevorzugte Farbe: Blau (eine alte Radiosendung)
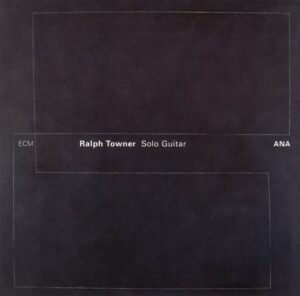
That was the title of an old Ralph Towner portrait of mine, now found with the help of Thomas Loewner in the deep archives of the radio station. It was exactly 30 years ago when the show was recorded and broadcasted. February 1996, few weeks after the release of his collaborative work „Lost and Found“. I‘ve heard this thing for the first time now since then. No surprise, that „blue hour“ included some of my favourites like „Solstice“, „Diary“, or „Solo Concert“.
A la recherche du temps perdu: while listening, I remembered the relaxed atmosphere of the interview in Dortmund, where he played a solo concert in the old „Domicil“. Ralph took his time to unfold thoughts and memories: the early years with Oregon, his first encounter with the 12-string, a detailed look at his way of composing and improvising solo. What you won‘t hear, is his deep and telling sigh when I mentioned „Solstice“. He spoke about another pure guitar solo album to be recorded soon. „Ana“, produced by Manfred Eicher in Oslo, was released in 1997 – and what a beautiful album that one is! Ask Mr. Whistler!
And
we go,
take your seat, a glass of wine,
thirty years ago today,
and listen!
„Musique pour la cuisine du Philippe“
Ich habe den „heiligen Gral“ von Roedelius verkauft, sein Tonbandarchiv. Nach dem Gespräch mit dem Käufer (auch hier führt wieder mal ein Weg nach Ostfriesland) blicke ich nach draussen – alles schneeweiss. Es dunkelt, zwei Kerzen, und ich lege mal wieder „Lux“ von Brian Eno auf. Vier Plattenseiten fesselnde „Ambient Music“ aus den 2010er Jahren. Horizont und zugleich Heimat. Viele der späteren Ambient-Werke von Brian sind nicht weniger erstaunlich oder gehaltvoll wie die frühen Klassiker, sie hatten allein dem Nachteil, in einer Zeit zu erscheunen, in welcher das Genre „Ambient Music“ geläufig geworden war, und nicht mehr Teil eines aufregenden Diskurses.
Michael, you know, the music doesn’t progress, per se; instead, Brian’s meditative blend of wafting keys and sporadic bass stabs are mentally rejuvenating. There’s an overwhelming sense of calm here, and the album remains intriguing, though it never strays far from its sonic centre. Through it all, Lux harbours a big sound through a minimal existence.
In dem Restaurant nahe des Jardin du Luxembourg (25, rue Servandoni) fand ich mich am frühen Mittag ein, an einem heissen Sommertag des Jahres 2013, um noch einen der begehrten Tische zu ergattern. Ich hatte dem Tip von einem Freund bekommen, weil die Besitzerin mittags gerne, kein Scherz, keine Fantasie, Enos Ambient Music auflegte, im Hintergund, wo sonst, und es lief tatsächlich Lux“. Nur einmal hat mich Enos Musik an einem öffentichen Ort dermassen überrascht – in den Jameos Del Agua auf Lanzarote gehörte „Music For Airports“ zum Inventar des guten Tons im Café oberhalb der Höhle.
Und hier nun „Lux“. Das Interieur der Gastatätte liess ans Paris der 50er Jahre denken, und die gleichermassen herbe, in die Jahre gekommene, unnachgiebige Schönheit der Chefin ein altes Paris wachwerdrn, das Robert Wyatt einst besungen hat. Leicht konnte ich mir vorstellen, wie sie einst Julio Cortazar eine krosse Entenbrust servierte, und Erik Satie auflegte. Zu Beginn ein Gazpacho, das alles in den Schatten stellte, was ich mir bisher unter einer erfrischenden Gemüsesuppe (mit ungekochtem Gemüse) vorstellte. Und dann der Hauptgang: zuvor hatte ich mit meinem Schulfranzösisch identifiziert, dass es sich um Kalbsfleisch handelt, mit Pfifferlingen, in Madeira geschmort oder flambiert. Und, als ich es mir munden liess, wusste ich sofort: nur ein unangefochtener Meisterkoch bringt eine solch abgerundete Komposition zustande, das Fleisch „au point“, auf den Punkt gebraten – die Pointe aber war, schlicht und ergreifend: ich mag keine Kalbsniere. Dessen ungeachtet, kann ich „La Cuisine du Philippe“ wärmstens empfehlen. Falls alle noch leben, und es den Laden im Winter 2026 noch immer gibt. Allein daran habe ich meine Zweifel.
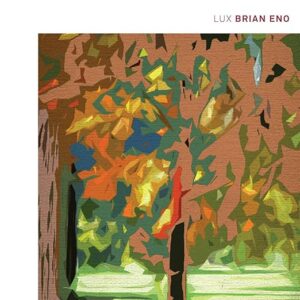
Vor wenigen Monaten, zog es mein etwas älteres Ich wieder in den Jardin du Luxembourg, in dem ich, und um den herum, ich genug Stunden der wahren Empfindungen erlebte, für einen sehr privaten Film voller Musik. Ich hatte das neue Werk der Necks dabei und legte mich zum Hören einss langen Stückes auf eine grosse Wiese dort. Als ich 20 war, sang und spielte dort im Park ein „hippie woman“ den grossen Song „Ohio“ von Crosby, Stills, Nash & Young. Ich sehe sie noch heute vor mir. Genauso wie die einstige Busfahrerin von Joe Zawinul, die ich dort im Quartier Latin kennenlernte, lang ist es her. Ich überquerte also, wieder und wieder in all den Jahren, die Rue Servandoni auf dem Weg zum Park, und vergass einfach, nachzusehen nach diesem alten Restaurant, das „Lux“ laufen liess an einem heissen Sommertag anno 2013. Das Cover allein, wie ein Blick in meinen Lieblingspark. „Warm Running Sunlight“. Prochain fois!Sirāt
Man muss aufpassen, wenn man sich grosser Themen annimmt – „between nothingness and eternity“. Ich glaube, genau so hiess das dritte Albums des Mahavishnu Orchestra, und seine Schwäche war das „overpowering“, die Musik wirkte hochtrabend, bedeutungsschwanger, und etwas hohl – kein Vergleich mit den beiden Vorgängern „The Inner Mounting Flame“ und „Birds Of Fire“. Oliver Laxe nimmt sich grosser Themen an auf Sirāt, und er benutzt dazu eine Geschichte, Sound, und die Sprache seiner Bilder. Nichts an diesem Meisterwerk ist hochtrabend.
Ein Wahnsinnsfilm. Vielleicht gelingt es mir, in meiner Ausgabe der Klanghorizonte im Mai ein Stück des Soundtracks aufzulegen. Aber was davor, was danach? Nicht leicht.
Jemand meinte kürzlich, ich würde wohl Filme danach bewerten, wie sehr sie mich emotional mitreissen. Das ist natürlich grosser Unsinn aus der Rubrik „gutartige Unterstellung“. Aber es gibt Filme, da hole ich gerne Erinnerungen hervor an Susan Sonntags Text „Against Interpretation“ ….
Es gibt Filme, da ist halt das erste, möglichst unvoreingenommene, Sehen, Erleben, Erfühlen eminent wichtig. Keine altkluge Hinführung, keine akademische Schubaldisierung …. Am hilfreichsten wären – vor einem Film wie Sirāt – ein paar Suggestionen, eine dezenteTranceinduktion a la Milton Erickson, für eine Reise, deren Ausgang niemand kennt.
Und jeder Leser dieser Zeilen schaue sich zu allererst SIRĀT an, lasse den Filn ein paar Tage und Nächte nachwirken, bevor, in irgendeiner Form, der „Analyse“ Raum gegeben wird, dem Drumherum …. und bevor man das weiter unten angegebene Interview liest. Oder die jetzt folgenden Zeilen, als „appetizer“ für ein hochinteressantes Gespräch! Also, STOP!!!!!
SIRĀT gibt es als blu ray, dvd, bei prime, und am besten, ab und zu, in einem Programmkino deines Vertrauens!

„Oliver Laxe spricht über Kino so, wie andere über Rituale sprechen. Das Kino ist für ihn eher ein „Tempel“ als ein Ort der Freizeitgestaltung. Er spricht in Rätseln, wenn er Gestalttherapie, Sufi-Mystik, Rave-Kultur und die Kraft der Bilder auf den Körper in einem Atemzug zusammenfasst. Immer wieder kehrt er zu der Idee zurück, dass Kino eher eine körperliche als eine rein intellektuelle Erfahrung ist. Diese Philosophie belebt Sirât, Laxes neuesten Spielfilm und sein bisher provokantestes Werk. Der Film spielt zwischen einer fast apokalyptischen Wüstenlandschaft und einer Underground-Rave-Party und entfaltet sich wie eine Feuerprobe, die die Zuschauer in Ekstase, Trauer und Erschöpfung treibt. Laxe setzte sich mit uns zusammen, um über seinen neuen Film, das Heilungspotenzial des Kinos und die Gemeinsamkeiten von Rave-Partys und Kino zu sprechen.“
Einmal vor langer Zeit im Kino Endstation
“This film is concerned with the interior experiences of an individual. It does not record an event which could be witnessed by other persons. Rather, it reproduces the way in which the subconscious of an individual will develop, interpret and elaborate an apparently simple and casual incident into a critical emotional experience.”
— Maya Deren on Meshes of the Afternoon, from DVD release Maya Deren: Experimental Films 1943–58.This story is concerned with the interior experiences of an individual. An jenem Abend war ich mit einer guten Freundin im Restaurant des Bahnhofs, wohl heute noch ein kultureller in-Treff – Jan Garbarek spielte da schon, Tocotronic, und Faust (ein geniales Konzert spät in den Neunzigern). Irgendwie hatte ich, was ich sonst nie habe, eine Vorahnung, des öfteren schweifte mein Blick durch den Raum. Es war später Nachmittag, die Küche hatte bereits geöffnet, die Netze des Nachmittags waren weit gespannt. Nach einem kurzen Gang zum WC kehrte ich zurück an unseren Tisch, und, neben dem kleinen hölzernen Podium dort passierte es.
Wer jemals das luzide Träumen geübt hat, weiss, dass eine Basisübung die Prüfung des Wirklichkeitszustandes ist: Träume ich oder bin ich wach? Durch alle Sinneskanäle hindurch wird die „Realität“, besser, „der Realitätszustand“, kritisch hinterfragt. Keine fünfzig Meter neben dem Kino, das „Meshes of the Afternoon“ aufführte, spielte sich, in anderer, hier ungenannter Zeit, eine leicht surreale Situation ab.
Unsere Blicke trafen sich, und ich will nicht sagen, dass ich vom Donner gerührt war – vom Blitz getroffen war ich. Sie hatte Engelslocken – fernab meiner sonstigen, urtyp-definierten Jagdgründe ein blondes Wesen. Was tun, in Bruchteilen von Sekunden? Wir kreuzten uns, keinen Meter voneinander entfernt. Ich drehte mich um. sie drehte sich um. Wir standen da wie angewurzelt, schauten einander in die Augen. Die Zeit stand mucksmäuschenstill, es könnten drei Sekunden gewesen sein. Die nächste Drehung, absolut synchron, und jeder setzte den eigenen Weg fort. This story does not record an event which could be witnessed by other persons. Or on the surface only, bit by bit.
Ich entschied mich für die galante Variante, und eine Pointe, einen Knalleffekt, der Jean Pierre Leaud, Truffauts alter ego, würdig sein sollte. Es ist doch cool, eine romantische Seele zu sein, erfindungsreich und furchtlos. Ich zahlte zügig unsere Rechnung, kutschierte S. nach Hause, 15 Kilometer, und fuhr mit dezent angezogenem Tempo zurück zum Bahnhof. Nichts sollte mich aufhalten, selbst von einem vollbesetzten Tisch mit Kind, Hund, und Ehemann, würde ich sie kurz nach vorne winken. Es gibt in Max Frischs „Mein Name sei Gantenbein“ diese Gedankenspiele zu Alltäglichkeiten, in denen eine profane Verrichtung, ein Schritt nach links oder rechts, einem ganz anderen Lebenslauf auf die Sprünge helfen.Rather, this story reproduces the way in which the subconscious of an individual will develop, interpret and elaborate an apparently simple and casual incident into a critical emotional experience. So, wie sie mich angesehen hatte, war hier keineswegs die alte Tante Projektion im Spiel, vielmehr pures „Wahr-Nehmen“, ein erster Blick, der tausend weitere enthielt. Eine Prüfung von „Realität“ der Marke „a thousand kisses deep“. (Leonard war mein Lehrer. All die Abende in Babsis Dachboden, Jahre, Jahre zuvor, mit Cohens endlosen Drehungen auf dem Plattenteller, liefen auf diesen Moment hinaus, ich hatte den „Stranger Song“ auf den Lippen, „Suzanne“ sowieso, bereit jeden Millimeter zwischen dem Müll und den Blumen abzusuchen.) Ich war schwarz gekleidet, bereit zur Eroberung. Django in love. Nach Paris, mais bientôt, ein Dutzend Liebesgedichte, gerne ein Song aus der Hüfte, wäre ich Bob Dylan – und der Bund fürs Leben sowieso! Sie war nicht mehr da.
An den folgenden Tagen und Wochen war ich häufig wie nie im „Bahnhof Langendreer“, ich gab einer Studentin, die dort kellnerte, und sich was traute, 100 Mark, und versprach ihr eine Menge mehr, sollte sie den Engel im Raum ausfindig machen (sie bekam eine Beschreibung, zehn Karten mit meiner Telefonnummer, ich nannte sie meine „Liebesdetektivin“). Sie machte einen guten Job, schoss ein paarmal ins Blaue, wie sie mir erzählte, doch der Engel tauchte nie wieder auf. Ich hätte schlichtweg sofort handeln müssen, in the moment. „And you want to travel with her, and you want to travel blind.“
Bill Bruford, master drummer & storyteller
Irgendwie kam ich auf flowflow vor Tagen auf meine liebsten Interviewpartner im Laufe der Jahrzehnte zu sprechen, und da darf in meinem Top 10 der Drummer Bill Bruford nicht fehlen. Wunderbar allürenfrei, ein authentsicher Gentleman, ein Künstler, der in seinem Leben sehr verschiedene Klangwelten erforscht und mitgeprägt hat – und nebenher noch ein exzellenter Storyteller ist, inhaltliche Substanz und pointierte Darstellung einswerden lässt. Das ist auch hier zu erleben, wenn man ihm gut zuhört, wenn er vom King Crimsons Klassealbum „Larks’ Tongues in Aspic“ erzählt. Ich traf ihn dreimal, in Kristiansand und zweimal in Köln – ein Künstler, der sofort eine entspannte Interviewatmosphäre herstellt, seinem Gegenüber natürliche Wertschätzung entgegen bringt, und einfach nur der Traum eines Musikjournalisten ist, in der Hinsicht, dass er einen fantastischen OTON nach dem anderen liefert, bestechend analytisch und dezent humorvoll.
Mit King Crimson erlebte ich ihn in Nürnberg 1982 mit 30000 Zuhörern – neben Neil Young war das „Discipline“-Quartett das Highlight eines langen Festivaltages – und sechzehn Jahre später auf der Bühne im Westfalenpark von Dortmund – ein weiterer Sommerabend voller Magie! Seine schon etwas ältere Autobiografie ist ein Muss für alle, die tiefer in Bill Brufords Denkweisen und Erlebnisse als Bandleader und Sideman eindringen wollen. Und sie ist en passant sehr witzig – das bessere Wort wäre „sophisticated“! HIER noch ein Auftritt von Bill Bruford als Interviewgast, der einen weiten Bogen schlägt – timewise, soundwise!
