2025 sum-up: best albums of the year



- Valerie June: Owls, Omens and Oracles – forward-thinking Americana soul-pop album that treats optimism as an active, hard-won stance, shaped by M. Ward’s warm, textured production.
Americana with folk, pop, blues, gospel, soul inflections. - Eliana Glass: E – an austere, intimate piano-led songwriting debut inspired by Carla Bley, Annette Peacock, and Nina Simone that makes reinterpretation feel like autobiography through phrasing, silence, and minute emotional shading
- Saba Alizadeh: Temple of Hope – A tense electro-acoustic collage that fuses kamancheh, modular synths, and historical radio into music suspended between rebellion and hope.
Avant-garde electronic, ambient, modern classical, drone, Middle Eastern traditions - Vijay Iyer and Wadada Leo Smith: Defiant Life – Trumpet and keys meet in long-form conversations that feel like politically attentive essays in sound, dedicated to liberation histories and lived resilience.
Spiritual jazz, free improv, chamber jazz. - Robert Plant: Saving Grace – Plant’s late-career reinvention leans into a rootsy touring band and cover versions, prioritizing communal feel over legacy spectacle.
Folk, blues, gospel, acoustic roots reinterpretations. - The Weather Station: Humanhood – A continuous, improvisation-informed flow that braids acoustic instruments and synth textures into an unusually vivid portrait of breakdown and tentative repair.
Folk-rooted art pop with jazz-leaning ensemble movement. - James Brandon Lewis: Abstraction Is Deliverance – surprisingly ballad-leaning quartet record that keeps the tenor intensity, but lets melody, patience, and space do the persuasive work.
Modern jazz in John Coltrane tradition, spiritual jazz, post-bop. - Amina Claudine Myers: Solace of the Mind – a distilled personal statement that threads gospel, blues, and jazz lineage into a direct, expressive document led by Myers’ keyboard language and voice.
Spiritual jazz, gospel-rooted jazz, blues. - Benedicte Maurseth: Mirra – Hardanger fiddle, wildlife sound, and subtle electronics create a specific landscape listening experience centered on the Hardangervidda plateau and wild reindeer.
Contemporary Norwegian folk, Nordic ambient folk, electro-acoustic chamber jazz. - Maiya Blaney: A Room with a Door that closes – challenging and slow-burning, both intimate and nervous record where small timbral details and restraint are the main drama.
Electronic Indie folk/rock, singer-songwriter from Brooklyn. - Barker: Stochastic Drift – A kickless techno/electronic album that uses harmonic surprise and “drift” as structure, making each track feel guided by curiosity rather than grid.
Ambient techno, experimental electronic, IDM with jazzy elements. - Goldie presents Rufige Kru: Alpha Omega – a drum&bass veteran’s update of classic jungle urgency that stresses long-form momentum and modern sound design over nostalgia
- billy woods: Golliwog – dense, horror-tinged rap album that turns dread and history into sharply lit scenes over a wide, unsettled palette of production.
Underground / alternative hip-hop - Saya Gray: Saya – shape-shifting set that splices folk guitar intimacy and studio mutation into songs that keep re-forming midstream.
Art pop, indie, folk, experimental singer-songwriter hybrid. - FKA twigs: Eusexua – club-minded pop record where precision dance production and elastic vocals make sensuality feel engineered and cinematic at once.
Alternative pop with electronic and dance orientations. - Erkki-Sven Tüür: Aeris – Tüür’s Symphony No. 10, scored for horn quartet and orchestra, unfolds as a single drama of shifting energies with seamless transitions.
Orchestral modernism, ECM New Series.
Contemporary chamber jazz, electro-acoustic piano, ambient minimalism. - Maria Iskariot: Wereldwaan – punchy Dutch-language punk album that pairs blunt hooks with a restless, DIY bite.
- Kronos Quartet and Mary Kouyoumdjian: Witness – A testimony-driven chamber work where spoken voice and string writing function like documentary memory, not decoration.
Contemporary chamber music, string quartet, documentary composition. - Signum Quartett: A Dark Flaring: Works from South Africa – a sharply curated set of contemporary South African string works, played with clarity that makes timbre and tension the narrative.
- John Glacier: Like a Ribbon – Rap treated as texture and atmosphere, where fragmented images and production detail carry as much meaning as plot.
Experimental UK rap, ambient-leaning electronic hip-hop. - Anika: Abyss – guitar-heavy, confrontational turn that amplifies Anika’s speak-sing into a raw rock record that stares back rather than soothing.
- Little Simz: Lotus – confessional UK hip-hop that threads jazz, punk, afrobeat, and funk into tightly written narratives about fallout and renewal.
- Annahstasia: Tether – Neo-folk debut anchored by an unmistakable low-register voice that makes quiet acoustic songs feel physically close and emotionally decisive.
- Loraine James: Whatever the Weather II – electronic miniatures indexed by temperature readings that feel like diaries of shifting states, porous between IDM, ambient, and pop fragments.
IDM, ambient electronic, experimental pop abstraction. - Rosalía: Lux – Structured in four movements and sung across many languages, Lux reframes orchestral pop as a modern oratorio that roars through genre, romance, and religion.
- Lonnie Holley: Tonky – Spoken-poetry narratives ride lush collaborative arrangements, turning autobiography into communal protest, grief, and tenderness.
Experimental folk-soul-jazz collage, spoken word, art-rock-adjacent production. - Christian Wallumrød: Percolation – Piano pieces that pivot from bent-note, church-tinged harmonies into playful experiments with synth sounds, beats, and treated autoharp.
Post-jazz, electro-acoustic, modern chamber ambient. - Jon Balke: Skrifum – Solo piano treated as an environment, with monophonic focus and processed space turning “writing” into audible texture.
- Jonny Greenwood: One Battle After Another – nervy, motif-driven film score whose string writing and tension architecture can stand as album listening, not just accompaniment.
- Meredith Monk: Cellular Songs – late-career summit that builds organism-like vocal pieces from simple motifs, expanding “cellular” logic into rich ensemble form.
Bonus Tracks:
Elton and Brandi: Who Believes in Angels? – Classic songcraft that thrives on contrast, pairing Elton’s melodic theatricality with Brandi Carlile’s direct, narrative drive.
Sokratis Sinopoulos and Yann Keerim: Topos – Lyra and piano trace a meeting point between Greek folk memory and chamber-jazz restraint. A beautiful, moving , intimate duo.
- Valerie June: Owls, Omens and Oracles – forward-thinking Americana soul-pop album that treats optimism as an active, hard-won stance, shaped by M. Ward’s warm, textured production.
Sentimental not sentimental
Letzte Woche saß ich in Bergen spät im Hostel mit ein paar anderen (jüngeren) Übernachtungsgästen am Tisch, und eine junge Norwegerin fragte mich, ob ich den Film „Affeksjonsverdi“ gesehen hätte. Ich musste nachfragen, konnte den Titel nicht zuordnen. Ich sagte, nein, aber ich hätte zwei Tage zuvor einen anderen norwegischen Film gesehen, über einen Vater und zwei Töchter, aber der Titel fiel mir nicht mehr ein. Dann sagte sie, doch das sei der Film, den sie meine. Sei sehr gut. Den habe sie eben gesehen. Ich sagte, nein, der Film hieß anders, es ging um einen Vater mit Problemen und seine zwei Töchter, der Film spielte in Oslo… und sie sagte, ja genau, ein Vater und zwei Töchter, spielt in Oslo. Ich war verwirrt, war ich schon so neben mir oder habe ich so schlechte Ohren? Es war klar, dass ich nicht den Film mit dem unaussprechlichen Titel gesehen hatte, kam aber nicht auf den Titel des Films, den ich in Oslo gesehen hatte. Ich beschrieb den Inhalt etwas genauer, es ging um Weihnachten und um zwei Töchter, und um einen Weihnachtsmarkt. Dann sagte sie: „Stargate heißt der Film.“ Sei nach einem erfolgreichen Buch. Ja, kein Wunder, dass ich mir den Titel nicht merken kann. Wer nennt einen Weihnachtsfilm auch „Stargate“? Was ein Unfug. Da denkt doch jeder, es wäre ein Film von Roland Emmerich. Ihren Film konnte ich noch immer nicht zuordnen, sie meinte, Elle Fanning spiele mit, was meine Verwirrung noch steigerte. Elle Fanning in einem norwegischen Film? Das kann doch nicht sein… macht sie sich über mich lustig?. Erst nach weiteren Details stellte sich raus, wovon sie sprach: Ich meinte, bei uns heiße der Film, den sie gesehen hatte, „Sentimental Value“.
Heute, also mittlerweile gestern, sah ich dann „Affeksjonsverdi“ bzw. „Sentimental Value“ hier in Berlin, auf dem Papier ein typischer „Europudding“: mindestens vier Länder und mindestens acht Produktionsfirmen und fast nochmal doppelt so viele Filmförderungsanstalten waren daran beteiligt. Ich frage mich: Was soll das? Warum müssen all die Filmfördergelder für deutsche Filmemacher von allen deutschen Filmförderungsinstitutionen so großzügig in alle möglichen Länder verteilt werden (letzte Woche sah ich den herausragenden brasilianischen Film „O Agento Secreto“, der ebenfalls viel Geld von deutschen Filmförderungen bekommen hat), wenn es dann für die deutschen Filmemacher fehlt, gerade wenn die kein Geld von irgendwoher bekommen und mit viel kleineren Summen schon zufrieden wären. Langsam ärgert mich das sehr. Jeder sagt, wie schwer es ist, in Deutschland Geld von der deutschen Filmförderung zu bekommen, weil man so viele Faktoren beachten muss, etwa, dass es deutsche Themen sein müssen, deutsche Regie oder Drehbuchautorenschaft, deutsche Handlungsorte, Drehorte in Deutschland, deutsche Wahrzeichen, deutsche Themen wie deutsche Geschichte oder Politik oder Gesellschaft… usw usf. Was haben „O Agento Secreto“ und „Affeksjonsverdi“ (um nur zwei von unzähligen Beispielen zu nennen), mit all diesen Faktoren zu tun? Gar nichts. Für viele deutsche Filmschaffende ist dies zunehmend ärgerlich. Bei den Filmfestivals in Cannes, Berlin, Venedig, Locarno usw. laufen mittlerweile stets zuverlässig jeweils fünf oder sechs Filme mit deutschen Co-Produzenten und deutschen Filmfördergeldern, die aber von all den von der Filmförderung bei deutschen Filmemachern eingeforderten Bedingungen, nichts vorzuweisen haben. Toll für Claudia Roth und ihren Nachfolger, dessen Namen ich immer wieder vergesse, saublöd für die nationale Filmkultur, die über mangelnde Fördergelder klagt.
Davon abgesehen ist „Sentimental Value“ einer dieser Filme, bei dem mir die Tränen kommen — nicht, weil ich mich aus eigener Lebensgeschichte so sehr mit den Charakteren und ihren Problemen und ihren Familiendramen identifiziere, dass ich aufgrund des sentimental value darin aufgehe und mitleide. Sondern weil der Film einfach so unfassbar gut ist. Oftmals kann ich auch bei sehr guten Filmen, während ich sie sehe, verstehen, wie die Filmemacher da hingekommen sind, also zu dem Ergebnis, das am Ende so gut geworden ist. Aber hier – der Film ist so gut, dass ich nicht mal so richtig verstehe, wie man einen so guten Film machen kann. Okay, Joachim Trier und Eskil Vogt haben zusammen schon einige Filme geschrieben und realisiert, die eigentlich alle mindestens sehr gut waren, teils auch grandios. Aber dieser, „Sentimental Value“, da bleibt mir die Spucke weg. Das ist phänomenal, wie gut das Ganze ist. „Kann man nichts sagen“, würde der Deutsche hier anerkennend sagen. Doch, eine Sache ist mir aufgefallen: Warum setzt Roxy Musics Same Old Scene (immer wieder ein wahnsinnig guter Song) einmal so laut ein, als Stellan „Gustav Borg“ Skargard mit dem Auto fährt? Weder ist es so gemischt, als würde „Gustav Borg“ das beim Autofahren hören (die Situation legt es aber irgendwie nahe), noch ist es schlüssig wieder ausgeblendet, sondern einfach ziemlich ruppig wieder rausgezogen, als Borg an seinem Ziel ankommt und dort das Haus betritt. Also bitte, in so einem makellosen Film hätte man das doch wohl auch noch besser lösen können. Vielleicht aber war das die eine Sache, die ich nicht verstanden hatte?
It’s not a bug, it’s a feature
Manchmal denke ich: wie schade, dass ich nie irgendwo auch mal Filmeinführungen machen darf, wie das viele Kollegen in Kinos bei Vor-, Neu- oder Wiederaufführungen machen (und dann sogar noch dafür bezahlt werden). Ein Film, der mir vorab gar nicht danach aussah, nach dem ersten Schauen dafür umso mehr für eine persönliche Einführung meinerseits, wäre dieses neue, wohl erste „Biopic“ über eine bestimmte Phase und einen Wendepunkt in der Laufbahn von Bruce Springsteen.

Der Titel kommt (im Film selbst) in einem sehr springsteen-typischen Schriftzug in großen, amerikanisch designten Lettern daher: SPRINGSTEEN – ergänzt um den Untertitel „Deliver me from Nowhere“, was ebenso gut der Name eines seiner Alben hätte sein könnte. Die Besprechungen zum Film sind zumeist recht verhalten, und so hatte ich nicht viel erwartet. Allerdings musste ich dann feststellen, dass der Film aus anderen Gründen verhalten aufgenommen wird, als ich dachte. Hier ein Beispieltext, in dem einiges als kritisch vermerkt wird, was doch letztlich positiv zu verbuchen ist – wenn man eben nicht das Konventionelle und Erwartbare im Kino will.
Ich habe mir den Film also angesehen, mit verhaltenen Erwartungen. Und obwohl die verlinkte Analyse irgendwie schon richtig ist, finde ich es seltsam, dass diese Punkte als „Fehler” dargestellt werden, obwohl sie offensichtlich alle beabsichtigt waren. Wenn man sich den Film ansieht, merkt man, dass er sicherlich nicht für ein möglichst großes Publikum gedacht ist wie Bohemian Rhapsody oder Rocketman. It’s not a bug, it’s a feature. Ich war tatsächlich überrascht, dass der Film viel subtiler und interessanter war, als ich erwartet hatte. Gerechnet hatte ich mit einem okayen Film im typischen Arthouse-Mainstream-Stil. Geboten bekam ich aber eine klug gedachte und fein inszenierte Geschichte über künstlerische Schaffensprozesse, über Depression und darüber, wie das Macho-Image, das Springsteen schon damals zugeschrieben wurde, so gar nicht zu seinen eigenen Ansichten, Ansprüchen und Ambitionen als Mann und Künstler passte. „Deliver me from Nowhere“ erzählt eine wirklich ehrliche und offene Geschichte darüber, sich selbst treu zu bleiben, gegen alle inneren und äußeren Kräfte. Und damit kann ich sehr viel anfangen.
Teils kann man wohl einwenden, dass es teils ein wenig unentschieden ist zwischen fein und leise erzähltem Autorenfilm und typischen Arthaus-Konventionen; so ist die Filmmusik an zwei, drei Stellen etwas emotionalisierend, die Auflösung der Vatergeschichte schrammt auch am Kitsch, und ein bis zwei zentrale Nebenfiguren sind vom Drehbuch sehr stark als Erklär-Bären eingesetzt, gerade so, als wären es die „O-Töne“ oder „Talking Heads“, die die nachgestellten, fast dokumentarisch gemeinten Szenen des persönlichen und kreativen Ringens im Rückblick noch einmal für alle im Publikum sauber erklären. Aber diese – sicher auch nachvollziehbare – Unschlüssigkeit hält sich dann doch in Grenzen. Und so möchte ich fast sagen, in dem Film verbirgt oder versteckt sich eigentlich ein anderer.
Dramaturgisches Gerüst im Zentrum der Geschichte ist eine ganz interessante, auch ungewohnt – aufrichtig und ernst – erzählte Männerfreundschaft. Und auch darüber hinaus scheint mir sehr interessant, wie dieser Film von Männerbildern und Männerrollen erzählt. Es geht ja, wie man aus dem Trailer und der ersten Szene im Film sofort erkennt, um Bruce Springsteens Beziehung zu seinem Vater — und darum, wie die Erziehung, die Kindheit und in diesem Fall im Besonderen das Verhältnis zum Vater einen Mann prägt, und was man daraus macht, zum einen als Künstler, in einer künstlerischen Form, zum anderen was man biografisch daraus macht, in seinem Leben. Für sich genommen wäre das ein alter Hut.
Auf der erzählerischen Oberfläche geht es somit um künstlerische, kreative Prozesse und um den Schaffensprozess hinter dem Album „Nebraska“, und das macht der Film schon ganz gut und überzeugend: Man glaubt sofort, dass es wirklich so gewesen sein könnte, approved by Bruce Springsteen. Es geht darüber hinaus aber vielmehr um das Ringen der Hauptfigur mit bestimmten Fragen, die in eine recht lose (fast möchte man sagen: dürftige) Story mit eher unspektakulären Konflikten eingebettet ist. Und so habe ich mich beim Schauen gefragt, wie es Leuten wohl geht, die mit Springsteens Werk und Biografie nicht so wirklich vertraut sind. Zuerst dachte ich, der Film müsste in diesem Fall total langweilig sein, weil sonst ja eigentlich nichts Sehenswertes erzählt wird. Zum einen haben Leute, die Springsteen kennen und den Film deshalb sehen wollen, sicher eine bestimmte Erwartungshaltung — auch wenn man gerade seit der Veröffentlichung seiner dicken Autobiografie und vielen anschließenden Interviews um seine Depression weiß und um sein Ringen um Selbstbild und dem Star-Image, für das er viele Jahrzehnte lang stand.
Doch was die Depressionen mit ihm gemacht haben, gerade auch im Kontrast zu dem markigen, männlichen Image, das er so lange verkörpert hat, hat Springsteen seither offen berichtet, ist daher für jene, die sich in den letzten Jahren einmal mit seiner Biografie befasst haben, keine Neuigkeit, Und doch finde ich bemerkenswert, wie dieser Film davon und von Männerfiguren in Amerika erzählt – und das auch unerwartet unaufdringlich tut. Dass der Film mit dem Versprechen, dass man jetzt ein, zudem vom Protagonisten selbst autorisiertes, Biopic zu sehen bekommt, wirbt, aber uns dann letztlich einen Film über Männerbilder – auch über die Generationen und Zeiten hinweg sozusagen – und über einen „starken“ Mann, der sich eine Depression eingestehen muss, bietet, fand ich unerwartet. Und offenbar nicht nur ich, denn dieser sehr ruhige, ja bedrückte Film war kein Erfolg an den Kinokassen. Denn wer sollte ihn auch schauen? Für viele Springsteen-Fans ist all das kaum attraktiv für einen Kinobesuch, denn der Film bedient so gar nicht die „Big Star“- und „American Hero“-Geschichte; und Leute, die für Springsteen aufgrund seines Images ohnehin nicht gerade viel Interesse übrig haben, ja auch nicht. Beide würden eben einen anderen Film erwarten.
Daher ist es eben vielleicht gerade ein Film für jene, die mit derlei Erwartungshaltung gar nicht erst vorbelastet sind. Letztlich ist es ein viel kleinerer „Indie“-Film, als man erwartet, gerade auch im Zuge der vielen (sehr erfolgreichen und groß angelegten) Biopics über andere Stars der populären Musikwelt in den letzten Jahren, die stets klangvoll damit enden, dass der Star am Ende mit dem großen Erfolg aus der Krise hervorgeht. Wie es 1984 mit Springsteen weiterging, das wissen wir; der Film erzählt es aber nicht.
Wim
Zu meinem Kurzbesuch in Bonn kam ich zwar pünktlich nach Zeitplan an, hatte mir dreieinhalb Stunden für die Wenders-Ausstellung in der Bundeskunsthalle eingeplant, stellte dann aber bei meiner Ankunft vor Ort fest, dass direkt gegenüber im Kunstmuseum gerade eine Retrospektive mit Werken von Gregory Crewdson stattfindet (wohl aus Wien herüber gewandert). Dass ich mir das entgehen ließe, stand außer Frage, und sei es nur für einen etwas beschleunigten Besuch. Wie oft kann man diese spektakulären Bilder schon im Original sehen? Und dann gleich noch als Karriere-Überblick!
Nach einer knappen Stunde, natürlich unverschämt kurz für die 70 gezeigten Werke des Bildkünstlers, für dessen Arbeit seit langem eher die Bezeichnung Regisseur als die des Fotografen passt, kam ich nicht umhin, zwei Bildbände zu kaufen, da die überraschend bezahlbar waren. Auch als Recherche für meine weiteren Überlegungen für einen Dokumentarfilm über einen Fotografen sicher von Nutzen.
„Was macht die Qualität eines Filmes aus? Natürlich gibt es objektive Qualitätsmerkmale, die man auch sehen lernen kann. Vor allem aber ist ,Qualität' eine subjektive Wahrnehmung. Ein Film kann den einen begeistern oder berühren und die andere eben gar nicht. Das mag damit zu tun haben, dass wir in Filmen oftmals unser eigenes Leben reflektiert sehen, dass wir uns aus den unterschiedlichsten Gründen mit einzelnen Figuren identifizieren, oder dass Filme Wünsche oder Sehnsüchte in uns wecken können, von deren Existenz wir bis dahin keine Ahnung hatten. Am besten lässt sich erkennen, wie gut ein Film (für uns) war, wenn er noch lange in uns nachklingt, wenn wir uns an den Film oder an Szenen des Films erinnern, als wären es unsere eigenen Erfahrungen, als wäre der Film ein Teil unseres Lebens geworden ..."

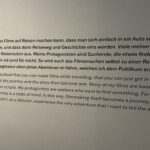

Also blieben mir noch zweieinhalb Stunden für Wenders, direkt gegenüber, und das schien mir noch bei den ersten Ausstellungstücken auch eine gut ausreichende Zeit zu sein, doch wird die Ausstellung, je weiter man durch sie hindurchgeht, immer zeitverlangender. Man trifft auf viele sehr gut kuratierte Filmausschnitte und beeindruckend umfangreiche Materialien aus Wims Laufbahn: etliche Gemälde aus seiner Frühzeit, die vielleicht nicht weltbewegend sind und denen man ihre Einflüsse auch deutlich ansieht, die allerdings zumindest ich zuvor aber nie gesehen hatte, unzählige Recherchematerialien von allen möglichen Projekten vom Debütfilm Summer in the City bis zum bisher letzten, Perfect Days, Fotografien in allen vorstellbaren Größen und Qualitäten, Arbeitsfotos, private Stücke und Einblicke in seine Inspirationen und Einflüsse … usw.…. dann gibt es auch ein paar 3D-Filme zu sehen, die man sonst kaum einmal zu Gesicht bekommt und von denen ich nicht einmal wusste… es gibt vier von Wenders eigens für diese Ausstellung editierte Multikanal-Installationen, die vielleicht nichts eigentlich Neues bieten (doch, ich entdeckte unter den vielen verarbeiteten Ausschnitten einen Filmtitel, von dem ich wohl noch nie gehört hatte), aber in der Neuanordnung und vor allem der monumentalen Größe und der dazu editierten Musik doch beeindruckend sind – darunter eine wilde Collage zum Thema Fahrten und Reisen zur Musik von Canned Heat.



Und dann gibt es am Ende auch noch zahlreiche Drehbuch-, und Arbeitsseiten zum Lesen, nebst Briefkorrespondenzen mit Leuten wie Willy Brandt, Nick Cave, Lou Reed… einen Darstellervertrag mit Gorbatschow (In weiter Ferne, so nah), Original-Drehbücher aus Wims Studienzeit, von teils verschollenen Filmen, weitere Nebenwerke wie ungewöhnliche Werbefilme und einen Kurzfilm zum 80. Jahrestag der Kapitulation (auch im „Zeit“-Podcast angesprochen), alles in Form von Bildschirmen mit Kopfhörern, Interviews… und einiges mehr… ich konnte am Ende dann doch nicht mehr alles ordentlich betrachten, durchlesen und anhören, diese vielen Materialien in den unmittelbaren Schreib- und Vorbereitungsprozess konnte ich leider nicht mehr ausreichend betrachen (und mein Smartfon hatte längst keinen Akku mehr, um noch etwas abzufotografieren) und wurde um 18 Uhr als letzter aus den Ausstellungsräumen hinauskomplimentiert. Daher habe ich sogar vergessen, wenigstens einen Blick auf die große Wand mit den Trophäen zu werfen. Nur den Goldenen Löwen habe ich im Vorübergehen gerade so gesehen.



Wenn die Ausstellung in wie auch immer veränderter Form im nächsten Jahr nach Frankfurt wandert, muss ich wohl noch einmal hin. Wie man auch zu diesem oder jenem einzelnen Film von Wenders stehen mag, der unglaubliche Reichtum allein seines Kinoschaffens und der von ihm (und ggf. Kameraleuten) geschaffenen Bilder ist wohl in dieser Form und Fülle ohne Vergleich. Ein großes, vielschichtiges Werk sondergleichen, quer durch die Jahrzehnte und Themenabschnitte auch von Wim selbst kommentiert, so zum Beispiel hier über Orte und Amerika im Speziellen und über das Reisen.
Saving Grace

Gestern habe ich mir mal ein paar – zumindest für mich – ganz neue Neuerscheinungen aus dem (auf den ersten Blick) Classic-Rock-Segment zugelegt: neben dem Tweedy-Dreier-Album die toll kuratierte 2-CD-Kompilation mit 38 Songs aus 60 Berufsjahren Ronnie Woods, die von einer Wood-Komposition der Birds 1965 bis zu vier bislang unveröffentlichten Stücken reicht – Fearless: Anthology 1965-2025 – mit einigem ziemlich Bekanntem (’ne Handvoll Faces-Klassiker, ’ne Handvoll Stones-„Deep Cuts“ mit Wood-Co-Writing-Credit, die Jeff Beck Group, drei klasse Rod-Stewart-Perlen usw.) und einigem weniger Bekanntem, bspw. einem Duett mit Mick Jagger aus dem Jahr 1974, also vor Ronnies Zeit bei den Stones (von seiner ersten Solo-Scheibe I’ve Got My Own Album To Do) und einigen weiteren Stücken von seinen Solo-LPs, darunter auch Dylans Seven Days).
Vor allem aber die neue LP von Robert Plant: Saving Grace – und die ist fantastisch. Sehr intensiv, sehr eigen, sehr berührend, bin begeistert, wird garantiert in meiner Jahres-Top10 auftauchen. Schade, dass Plant nur noch so selten neue Platten macht – aber wie toll, dass die dann zuverlässig so große Klasse sind.
Plants letztes Soloalbum war Carry Fire, und dass das bereits 2017 war, überraschte mich selbst gerade. Für manche Leute sind acht Jahre ja ein kompletter Karrieren-Zeitraum. Auf Saving Grace widmet sich Plant weiter seinem Herzensprojekt seiner späteren Jahre, die Traditionen US-amerikanischer Musik auf raffinierte, berührende Weise in die Gegenwart zu holen. Vielleicht nur Dylan gelangen vergleichbar zeitlos klingende Neuaufnahmen uralter Songs jenseits von Folk und Gospel. Dass neben Memphis Minnie (die älteren von uns erinnern sich an When The Levee Breaks vom vierten Zeppelin-Album) und Blind Willie Johnson auch mal wieder eine Nummer von des (mittlerweile nicht mehr existenten) Duos Low aus Dylans Heimatstadt Duluth, Minnesota, dabei ist, fällt einem erst einmal gar nicht auf. Zehn meisterlich arrangierte Stücke, die gewissermaßen eine intensive Reise durch ein Jahrhundert US-Roots-Musikgeschichte bieten und Türen in alle möglichen Richtungen öffnen.
Hass und Heat
In Berliner Kinos laufen aktuell zwei Filmklassiker aus dem Jahr 1995. Das war wohl das Jahr, in dem sich mein Kinointeresse zu einem veritablen Berufswunsch formierte. La Haine (Hass) von Matthieu Kassowitz habe ich interessanterweise nie gesehen, ich meinte wohl immer (vermutlich durch die Berichterstattung bzw. Rezeption), das wäre ein Film, der sich als Epigone von Scorseses Siebziger-Jahre-Schaffen und dem damals mega angesagten Frühwerk von Scorsese-Schüler Tarantino geriert, zudem auch noch in Schwarzweiß (für mich lange Zeit in den meisten Fällen der Inbegriff des artsy selbstverliebten Autorenkinos) mit ein paar jungen Typen als Hauptfiguren, die beim Herumhängen in Paris infantile Machosprüche raushauen, Drogen konsumieren und mit Waffen hantieren, was mich alles einfach nie die Bohne interessierte, als Filmzuschauer auch nicht. Und was soll ich sagen, ich hatte drei Jahrzehnte lang genau das richtige Bild von dem Film. Natürlich hat er tolle Kameraarbeit, und die Musikauswahl macht auch Spaß… aber irgendwie berührt hat mich das ganze Ding dann doch nicht. Von dieser Art Herumhänger und Sprücheklopfer hab ich seither hier in Berlin eh mehr als genug jeden Tag.
Einen Tag später mal wieder Michael Manns Heat, der vor 30 Jahren sicherlich enorm einflussreich auf mein Verständnis von Kino war, und den ich alle zehn Jahre mit großer Begeisterung gesehen habe und jedes Mal noch besser fand, nun als neu restauriere digitale Fassung. Interessant, dass mich dieser Film nicht kalt lässt, schon damals als Jugendlichen nicht, geht es doch um zwei lebenserfahrene Männer nach Jahrzehnten im Beruf, die allem ein bisschen überdrüssig sind. (Und ja, mit Waffen hantieren.) Überhaupt ist Michael Mann ein ausgesprochener Männer(figuren)-Regisseur; in der Folge von Heat habe ich mich allen seinen Filmen eingehend gewidmet und seine Regiearbeit intensiv studiert, und immer wieder frage ich mich, ob das eigentlich so die einzigen Männerfilme sind, mit denen ich was anfangen kann. Offenbar schafft(e) Michael Mann es, weit darüber hinaus sehr vieles und und sehr tief zu erzählen, so dass man sich auch in diesen Filmen wiederfinden kann, wenn man nicht Meistergangster oder LAPD Detective ist.
Außerdem die grandiose, quasi dokumentarische Verwendung von zahlreichen unglamourösen Hinterhof-Drehorten in L.A. — was sollte mich das vor 30 Jahren interessieren… hat aber bei mir als BRD-Kind offenbar viel angesprochen, dieses aufmerksame, von aufrichtigem Interesse geprägte Erzählen eines „anderen“ Los Angeles. (Heute würde man sicherlich weit mehr Schwarze und „People of Color“ besetzen.) Und dann ist der Film natürlich von einer phänomenalen Regie und Filmsprache gezeichnet; das hat mich sicherlich geprägt, wie Michael Mann mit einer solchen souveränen Meisterschaft immer haargenau den richtigen Ton trifft, eine Leistung auf dem Höhepunkt seines Könnens — offenbar wie die beiden Hauptfiguren.

Wir haben den Film mit der Tochter angeschaut, die mit ihren 16 Jahren heute fast so alt ist wie ich damals. Auch ihr hat der Film sehr gut gefallen (bei La Haine hätte sie sich, jede Wette, gelangweilt). Witzigerweise hat sie anfangs die beiden Hauptfiguren verwechselt — für Menschen meiner Generation natürlich skurril, De Niro und Pacino zu verwechseln, aber in diesem konkreten Fall eigentlich in gewisser Weise auch wieder „richtig“.
Hätte ich vor 30 Jahren La Haine gesehen und nicht Heat, wäre mein Kinoverständnis und meine wären meine Vorlieben heute ganz andere?
Zum 20. Juli

Zum Wochenende in der Passionskirche, Kreuzberg: Bill Callahan auf seiner ersten Europatournee seit elf Jahren. Proppenvolles Haus, langer Applaus, doch Callahan bleibt bei seinem sehr präzisen Programm, Start Punkt 20:30, Ende Punkt 22:00. Sehr kurze Zugabe („Let’s move to the Country“), zwei Songs weniger als bei anderen Konzerten der Tour. Dennoch ganz famos, wie der Texaner ganz allein mit einer elektrischen Gitarre, ein paar Pedalen und einem Becken alle begeistert. Und dann, nach dem Konzert beim besten Willen so lange hinter der Tür bleibt, bis wirklich restlos alle Menschen das Weite gesucht haben oder schließlich hinauskomplimentiert worden sind. Gemeinsam mit zwei älteren Herren warte ich noch eine gute Stunde vor der Kirche, um wenigstens zwei Platten signiert zu bekommen. Wer weiß, ob und wann der gute Mann sich hier noch einmal blicken lässt. Einer der beiden Männer ruft Callahan zum Abschied zu: „Don’t forget us.“ Im direkten Vergleich mit Callahans sehr freundlichem „Opening Act“, einem jüngeren, aber nicht mehr ganz jungen Mann an einer Gitarre, ebenfalls aus Texas, zeigt sich auch frappierend augenfällig, wie enorm die Welten zwischen ganz nettem persönlichen Liedermachen und der großen Kunst der Einfachheit eines autobiografisch durchzogenen, aber erstklassigen Songwritings sein kann. Obwohl Callahan seine Songs in dieser reduzierten Form darbietet, geht das tief.

Tags zuvor in Potsdam: Performance-Künstlerin Ellen Kobe veranstaltet eine „Podiumsdiskussion“ (ja, in Anführungszeichen) zum 20. Juli über einen Film, an dem wir über zwei Jahre gearbeitet haben, der aber mangels Geld nie gedreht wurde, „Stauffenbergs Tasche“. Auf meinen nur halb ernst gemeinten Ratschlag bei Andres Veiels „Riefenstahl“-Premiere hin hat Ellen nun eine öffentliche, knapp 90-minütige Gesprächsrunde mit realen Personen über den Film organisiert, mit Filmemacher Andres Veiel, der Hauptdarstellerin des Films (HFF-Schauspielprofessorin, die auch Studenten ihrer Universität mit in die Besetzung brachte) und einem kenntnisreichen Militärhistoriker, plus umfangreiches Intro/Grußwort von Schirmherr Olaf Scholz (seine Zusage stammt noch aus der Zeit, als er Kanzler war und noch nicht abzusehen war, dass er zum aktuellen Zeitpunkt bereits frühzeitig sein Amt an Herrn Merz weiterzugeben hätte). Keiner der zahlreichen Zuhörer erfährt, dass es den Film nicht gibt, aber viele fragen hinterher, wo man ihn denn sehen könne. Insofern ist die Veranstaltung ein Erfolg — und eine weitere Etappe in Ellens Gesamtwerk, das ich seit einigen Jahren audiovisuell begleite.
Patti Smith in Berlin
Vor dem Konzert sah ich, dass demnächst die Smashing Pumpkins in der Zitadelle auftreten werden. Nun bin ich sicherlich kein Fan der Band, aber die Augen offenhalten nach günstigen Karten werde ich mal. (Ich denke aber, das wird mir am Ende zu teuer sein.) Billy Corgan hat mich in mehreren Interviews zuletzt durchaus positiv überrascht, und man hört immer wieder, wie gut die Band in Konzerten wohl immer noch sein soll. Im letzten Gespräch mit Joe Rogan, das ich letzen Monat während meines jüngsten USA-Roadtrips anhörte, meinte er, für einige, die sein Werk nicht eingehender kennen, werde er halt immer der „Rat in a Cage Guy“ bleiben; damit müsse man seinen Frieden schließen.
Bei Patti Smith rechnet man ja mit so einigem, und nachdem sie seit ihrem letzten Berliner Besuch Ende 2023 Charlotte Day Wilsons Work in ihr reguläres Programm aufgenommen hat, überraschte sie gestern mit der Premiere von Bullet with Butterfly Wings von … den Smashing Pumpkins. Mit der berühmten Textzeile „Despite all my rage I’m still just a rat in cage“. (Auf der Setlist stand der Song offenbar sogar als „Rat“.) Es gab ein, zwei falsche Starts, erklärtermaßen weil es wirklich der erste Versuch war, Patti Smith las den Text zuerst ab und fragte nach dem ersten falschen Einstieg Bassist Tony Shanahan um Rat, aber dann kamen sie und die Band gut rein, und auch wenn es sich auch noch ein bisschen unsicher anfühlte, meinte sie hinterher, vor 50 Jahren sei sie vor 75 oder 100 Leuten aufgetreten, wenn sie mal einen Song ausprobiert habe — nicht wie heute vor so vielen Tausenden. Sie werde die Energie und Unterstützung des Publikums mitnehmen, den Song auch zukünftig ins Programm zu nehmen. Das Publikum war überhaupt enorm auf ihrer Wellenlänge — viele sehr junge Menschen, einige ältere… so ganz anders als z.B. vor bald 25 Jahren, als ich sie auf der Museumsinsel sah, damals auch ein viel kleineres Konzert, bei dem sie, damals Anfang-Mitte 50, auch noch deutlich wilder mit der Gitarre rockte. Damals bestand das Publikum aus sehr vielen anscheinend lesbischen Paaren und vereinzelten Kennern. Heute, mit Ende 70, tritt sie in allen Ländern vor fünf- bis zehntausend Leuten auf, und dabei gelingt es ihr wie kaum jemandem, die Brücke von verbindendem Hymnen wie People have the Power und Because the Night mit der Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts zu verbinden. Da trägt sie mal ein Gedicht vor, erzählt von der Autoindustrie im Detroit in ihrer Kindheit, schickt Grüße an Ginsberg, Burroughs und Johnny Cash, fordert die Menschen dazu auf, für ihre Freiheit einzustehen und das Territorium der Native Americans zu würdigen (Ghost Dance) und interpretiert allabendlich Songs von jüngeren und älteren Songwritern.
Da in Berlin auch Work wieder in der Setlist war, sowie außerdem Steve Earles Transcendental Blues, musste das gestrige Programm leider ohne eine ihrer stets tollen Dylan-Interpretationen auskommen. In Hamburg zwei Tage zuvor hatte sie sowohl Man in a long black Coat als auch One too many Mornings geboten, auf der 2023er Tour mit viel Feuer All along the Watchtower. Dafür gab’s gestern auch noch Cash vom 2004er Album Trampin’, laut eigener Aussage für Johnny Cash (†2003) und George Bataille geschrieben.
Und auch sonst gab’s so manche Hommage, etwa Spell (Footnote to Howl) zum bald anstehenden Hundertsten ihres „old pal“ Allen Ginsberg, wie 1959 (über die Detroiter Autos und die chinesische Invasion in Tibet und die Flucht ins Exil des jungen Dalai Lama)[1] vom großen Album Peace and Noise (1997). Wie immer auch das 1978 für ihren damaligen „boyfriend“ Fred und Vater ihres Gitarristen Jackson Smith geschriebene Because the Night sowie zum Abschluss die Empowerment-Hymne People have the Power, 1986 mit Ehemann Fred „Sonic“ Smith geschrieben, dessen Tod sie wiederum in Beneath the Southern Cross (1996) aufgreift, live als leidenschaftliches Carpe Diem ausgebaut und dargeboten – nachdem sie zu Beginn zwei Mal ihre Melodie auf der Akustikgitarre verhaut.
Ein sehr vielseitiges Programm von Stücken aus ihrer ganzen Karriere, mit Liedern von fast jedem ihrer Alben (ausnahmsweise diesmal nur kein Stück von Gung Ho). Eine Kollektion mit den seit dem letzten regulären Album 2012 angehäuften Cover-Songs wäre eigentlich ein wunderbares Geschenk nach dieser Tour. Am Ende waren alle offenkundig begeistert. Beeindruckend, wie es ihr gelingt, als Künstlerin zu so vielen Menschen verschiedener Generationen zu sprechen – und mit welcher Energie.

Foto von Tony Shanahan
(Hier reflektiert sie über ihren aktuellen Berlin-Besuch und das Konzert.)



