Lichtspiel
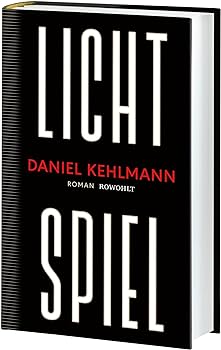
Wenn man der Kritik glaubt, dann muss Daniel Kehlmann mit Lichtspiel mindestens den besten Roman seit der Erfindung des aufklappbaren Regenschirms vorgelegt haben. Er ist auch, das sei vorweggenommen, wirklich gut. Trotzdem: Tyll (2017) fand ich besser. Aber das ist eine Frage von Nuancen.
Es geht in dem Roman um den österreichischen Regisseur Georg Wilhelm „G.W.“ Pabst (1885-1967), der zu den bedeutendsten des frühen deutschen Films gehört: Die freudlose Gasse (1925), Geheimnisse einer Seele (1926), Die Liebe der Jeanne Ney (1927), Die Büchse der Pandora (1929), Die weiße Hölle vom Piz Palü (1929, Co-Regie mit Arnold Fanck) — ich will sie nicht alle aufzählen; im Prinzip sind alle Filme Pabsts vor 1933 sehenswert, insbesondere deshalb, weil er anders als seine heute berühmteren Kollegen Fritz Lang, F.W. Murnau und Robert Wiene nicht so sehr den Spuren des Expressionismus folgte, sondern der Neuen Sachlichkeit. Dabei entwickelte er eine beeindruckende Filmsprache, wobei seine ganz große Spezialität im Schnitt, in der Montage lag.
Pabst galt als „rot“. Er war deshalb gut beraten, Deutschland zu verlassen, als die Nazis ans Ruder kamen. In Hollywood aber hatte er Pech: Er inszenierte einen Flop, und das verzieh man ihm nicht. Er bekam keine zweite Chance, sondern hätte als Regieassistent sein Leben fristen müssen. Das sah er nun als deutlich unter seiner Würde an. Seine wirkliche Tragik aber begann erst, als er mit Frau und Sohn nach Wien zurückkehrte, wo er einen Sanatoriumsplatz für seine demente Mutter finden wollte. Dort nämlich überraschte ihn der Beginn des Zweiten Weltkrieges — und er konnte das Deutsche Reich nicht mehr verlassen.
Kehlmann schildert in geradezu filmisch gedachten Schnitt- und Szenensequenzen, wie Pabst sich „arrangiert“, wie er eigentlich gegen seinen Willen beginnt, sich von den Nazis einspannen zu lassen. Seine Unterredung mit Goebbels (der namentlich nie genannt wird) gehört zu den Schlüsselpassagen des Romans — unendlich lange Korridore, ein unfassbar riesiges Büro mit einem Schreibtisch ganz am Ende, vor dem man auf dem Weg durch den Raum immer kleiner wird, und „der Minister“ ist einerseits die Höflichkeit selbst, lässt aber keine Sekunde einen Zweifel daran, dass er auch anders könnte. Und vor allem daran, dass Pabst Kriegsgefangener und als solcher von des Ministers Gnade abhängig ist. Eine Szene, die einem kalt den Rücken herunterläuft. Eine besondere Hintertreppe tut sich dadurch auf, dass Pabst die Tatsache, Kriegsgefangener zu sein, auch als Entschuldigung dafür einsetzt (sich selbst und anderen gegenüber), sich auf die Nazis überhaupt eingelassen zu haben. Man würde sich nicht wundern, wenn „der Minister“ das genau so einkalkuliert hätte.
Auch Trude, Pabsts Frau und Drehbuchautorin, wird mithilfe eines Lesekreises in die NS-Szene geholt, der die Schundromane eines Herrn Karrasch in den Himmel hebt. Dessen Schmachtfetzen Die Sternengeige muss Pabst schließlich verfilmen, und darüber wird ihm klar, dass die Statisten, die er herumschubst, KZ-Häftlinge sind. Sein letzter Film, Der Fall Molander (1945), den er selbst für seinen besten hält, geht verloren. Und weil das alles noch nicht reicht, wird auch Pabsts Sohn, eigentlich ein amerikanischer Junge, ein Anhänger der HJ.
Ich will hier nicht die ganze Geschichte erzählen. Sie beruht auf Recherche, ist aber um Eigenerfindungen des Autors erweitert, wie das in letzter Zeit ein wenig in Mode geraten zu sein scheint. Viele Zeitgenossen und Kollegen Pabsts tauchen auf, teils als Gesprächsthemen und Klatschobjekte, teils real, darunter Schauspieler wie Heinz Rühmann, Paul Wegener und Werner Krauss, auch eine Leni Riefenstahl, die so widerlich ist, dass man fast Mitleid bekommt. Aber auch die klassischen Mitläufer fehlen ebenso wenig wie die, die mit Begeisterung dabei sind und später von nichts gewusst haben wollen.
Der Ton des Romans ist vielseitig, den jeweiligen Szenen und Perspektiven angepasst. Kehlmann kann sowas, das hat er schon in Tyll gezeigt. Hier allerdings treten gelegentlich Längen auf, einiges ist mir schlicht rätselhaft-verworren geblieben, manches kommt mir ein wenig gewollt atemlos vor. Ein gutes Buch also auf jeden Fall, aber der annoncierte Jahrhundertroman ist es nicht. Immerhin aber ein echter Pageturner, und ich tippe mal, auf eine Verfilmung werden wir nicht lange warten müssen.
