Doppelgänger
„Die New York Trilogie“ war das erste Buch von Paul Auster, das ich gelesen habe, in der zweiten Hälfte der 90er. Gleich der erste Teil, „Stadt aus Glas“, ist eine Story, die jedes auch nur annähernde Gefühl von Gewissheit, Zuversicht und der Möglichkeit von Kontrolle auf faszinierende Weise zerstört. Durchdachtes, systematisches und scheinbar vernünftiges Vorgehen wird ad absurdum geführt. Konturen verschwimmen, so wie das Gespür für den Raum und die Zeit. Auch das Subjekt verschwindet. Im Jahr 1994 erschien „City of Glass“ als Graphic Novel, von Paul Karasik und David Mazzucchelli. Erst jetzt habe ich dieses Buch gelesen bzw. angesehen. Die visuelle Umsetzung ist ein ästhetisches Meisterstück. Sofort lebte ich wieder ganz gebannt in der Welt des Paul Auster, aber auf eine andere Art als gewohnt: in der visuellen Doppelgängerversion. Wer David Mazzucchellis Arbeit kennt, zum Beispiel „Asterios Polyp“ (vor zehn Jahren schrieb ich auf Manafonistas darüber, hier der Link), weiß, dass sie weit darüber hinausgeht, eine Story etwa in einer Aneinanderreihung von Film-Still-Pannels umzusetzen. Das Ziel ist immer, für die Besonderheiten einer Geschichte visuelle Äquivalente zu schaffen und damit weitere Nuancen oder Interpretationsmöglichkeiten hinzuzufügen.
Hier ein paar Beispiele, Details, ohne zu viel zu verraten. Daniel Quinn, die Hauptfigur (jedenfalls ein Name dieser Hauptfigur), sitzt über einen langen, unbestimmten Zeitraum in einem Häuser-Zwischenraum vor dem Haus seiner Auftraggeber, um sie zu beschützen. Die Dauer wird visuell veranschaulicht, indem Quinn mit der Mauer verschmilzt. Dass Quinn an dieser Stelle seinen Verstand verliert und mit einem anderen Blick auf seine Umgebung schaut, zeigt ein verwischtes Pannel.

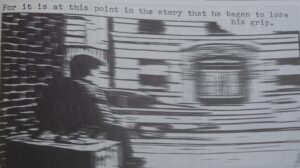
In der zweiten Hälfte des Buches trifft Daniel Quinn den Schriftsteller Paul Auster. Während Paul Auster von seinem aktuellen Buchprojekt erzählt, einem Essay über Don Quixote, und man bei einer filmischen Umsetzung oder einem konventionellen Comic erwarten könnte, dass die Bilder von einem der Männer zum nächsten wechseln, ändern Mazzucchelli und Karasik allmählich raffiniert die Perspektive. Plötzlich sehen wir die Männer beim Lunch als Schattenriss und im Vordergrund einen Teddybär, Baseballhandschuhe und einen Spielzeug-LKW. Es folgt der Blick ans Fenster, dann aus dem Fenster, von verschiedenen Stockwerken aus, und während man den Dialog der Männer weiterliest, fragt man sich gleichzeitig, wohin die Bilderfolge führen mag. Die Perspektive nähert sich schließlich dem Gehweg unten vorm Haus und einem rätselhaften Gegenstand, der dort liegt, dann erkennen wir einen Jojo, den eine Hand ergreift und ein paar Bilder später steht Paul Austers Sohn Daniel im Wohnzimmer und begrüßt den Gast. „City of Glass“ ist durchzogen vom Motiv des Doppelgängers, und Daniel ist sogar ein mehrfacher Doppelgänger.
Die größte Herausforderung war die Umsetzung der Rede eines Mannes, der als Kind neun Jahre lang eingesperrt war. Im Buch beschreibt Paul Auster diese Rede so: „Machine-like, fitful, alternating between slow and rapid gestures, rigid and yet expressive, as if the operation were out of control, not quite corresponding to the will that lay behind it.“ Die sprachlich in gebrochenem Englisch gehaltene Rede wird etwa so illustriert: Die Bilder nähern sich vom Körper zum Gesicht zum Mund, gehen in die Mundhöhle, dann in ein Gewässer, aus dem ein alter Mann mit einem Boot und Ruder auftaucht, der alte Mann führt die Rede fort, die Bilder gehen in seinen Mund, dort taucht eine Art Höhlenzeichnung auf, Formen verschiedener Gegenstände wiederholen sich in den aufeinanderfolgenden Bildern usw. bis zu einer vergitterten Tür und einer gebrochen liegenden Marionette. Immer wieder tauchen in der Graphic Novel Variationen einer Kinderzeichnung auf, die man als Zeichnungen des eingesperrten Jungen interpretieren kann. Über einer dieser Zeichnungen steht eins der Grundprinzipien postmoderner Literatur: „Everything becomes essence: The center of the book shifts, is everywhere…“
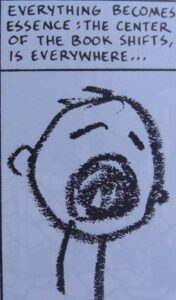
Doppelgänger finden sich auch außerhalb des Buches bzw. der Graphic Novel. Paul Auster ist einer davon. Ein anderer ist ein Schriftsteller, der sich mit grundsätzlichen Umwälzungen der Sprache um 1900 befasste und in eine Schreibkrise geriet: Hugo von Hofmannsthal. Der aus dem Gefängnis entlassene Mr Stillman beschreibt die Ausgangslage in der Graphic Novel so: „When things were whole our words could express them. But things have broken apart, and our words have not adapted.“ Es geht ihm darum, eine angemessene Sprache für die neue Gegenwart zu finden. Hugo von Hofmannsthal beschreibt in seinem Chandos-Brief ein ähnliches, aber anders gelagertes Problem: „Mein Fall ist, in Kürze, dieser: Es ist mir völlig die Fähigkeit abhanden gekommen, über irgend etwas zusammenhängend zu denken oder zu sprechen.“ Für Stillman stellt sich beispielsweise konkret das Problem, dass ein defekter Regenschirm nicht mehr als Regenschirm bezeichnet werden kann; deshalb erfindet er neue Wörter. Das ist sein Buchprojekt. Stillman glaubt also an die Möglichkeit, das Wesen der Dinge in die Sprache der Menschen zu übersetzen. Hugo von Hoffmansthal glaubte das nicht. Im Chandosbrief entwickelt er die Position, dass die Reflexion der Sprache selbst als Element moderner Literatur wesentlich ist.
Am 8. April 2025 erscheinen alle drei Teile von Paul Austers „New York-Trilogie“ als Graphic Novel, umgesetzt von Paul Karasik, Lorenzo Mattotti und David Mazzucchelli.
5 Kommentare
Olaf Westfeld
Ich habe die „New York Trilogie“ in den frühen 90ern gelesen, als Oberstufenschüler am Gymnasium in der Wüste (es heißt tatsächlich so). Auch das war (glaube ich) ein prägendes Erlebnis, ich habe danach immer wieder Bücher gesucht und besonders gemocht, bei denen einzelne Teile übrig bleiben, nicht zusammen passen.
Das Comic habe ich auch, liegt gerade neben mit. Meine Ausgabe ist in der „Neon Lit“ Reihe bei Rowohlt (rororo steht auf dem unteren rechten Rand) erschienen und ich habe dafür DM 16,90,- bezahlt. Es ist 1997 auf Deutsch erschienen und 1994 auf Englisch (nicht 2004). Ich kopierte mir damals die ersten 6 Bilder und hängte sie an die Pinwand über meinen Schreibtisch. Ich mochte, wie da mit Sein und Schein, mit Abbildern, mit Wirklichkeit, gespielt wird. Danke für den Hinweis auf die – erweiterte – Neuausgabe, ich glaube, die kaufe ich mir.
Martina Weber
Oooch, ich wäre auch gern auf einem Gymnasium gewesen, das Gymnasium in der Wüste heißt. Wie kommt das denn? Liegt es in einer Art Neubaugebiet? oder noch abgelegener?
Meins heißt Karl-Friedrich-Gymnasium, damals schon mehr als 300 Jahre alt, und in der Eingangshalle standen (und stehen wahrscheinlich immer noch) riesengroße Bronzestatuen berühmter Männer aus der Antike. Das war der Spirit.
Die Graphic Novel Lektüre: ich hätte nicht gedacht, dass sie mich so sehr berührt, nachdem ich vor einiger Zeit, nach dem Tode Paul Austers, „Die Musik des Zufalls“ wiedergelesen habe und nicht mehr ganz so angetan war wie damals.
Vielen Dank für deinen Hinweis der korrekten Erscheinungsdaten. Ich ändere das gleich. Ich habe mir die Graphic Novel erst kürzlich antiquarisch für ein paar Euro gekauft. Es ist die Ausgabe von faber and faber aus dem Jahr 2004.
Ja, und ich dachte mir natürlich, dass die erweiterte Neuausgabe etwas für dich ist 🙂
Olaf Westfeld
Streng genommen heiß es: Gymnasium „In der Wüste“, aber anders liest es sich doch netter. Die Wüste ist tatsächlich ein Stadtteil, kommt von „wüst“, also unbewohnbar. Altes Moorgebiet, das im 19. Jahrhundert erschlossen wurde, als die Stadt zu wachsen begann.
Der Spirit war ein 70er Jahre Neubau. Relativ hell, viele Treppenhäuser, lange Gänge.
Ich habe mir die Neuausgabe gestern noch bestellt, berichte dann gegebenenfalls. Danke für den Hinweis! Mein Arbeitgeber spendiert monatlich €50,- auf eine Einkaufskarte (edenred), die auch im Buchladen funktioniert; das macht es für mich immer sehr verlockend, mal ein Buch zu kaufen.
Von Auster habe ich vor gar nicht so vielen Jahren – vielleicht kurz vor der Pandemie? – „4,3,2,1“ gelesen. Das hat mir damals sehr gefallen! Ich ahne, dass mir viele der alten Bücher auch nicht mehr gefallen würden… Auster ist aber einer der Autoren, von denen ich am meisten gelesen habe.
Martina Weber
Auch so ist es ein bemerkenswert schöner Name für eine Schule.
70er Jahre Neubau als Schule kenne ich auch. Das war meine Grundschule („Brüder-Grimm-Schule“). Ja, lange Gänge, Teppichboden und zur Orientierung gab es Gebäudeteile in elementaren Farben wie die kleinen Plastikplättchen für die Mengenlehre: gelb, rot, grün und blau.
Für mich ist Paul Auster auch einer der wichtigsten Romanautoren gewesen und der, von dem ich am meisten gelesen habe, und über einen langen Zeitraum. „4-2-3-1-“ habe ich aber nicht gelesen. Das hat wohl ein anderes „Rezept“, da du es erst vor ein paar Jahren gelesen hast, aber meinst, dass dir die früheren Bücher nicht mehr gefallen würden. (Ich weiß ganz grob, worum es geht.) Ich war selbst überrascht, dass mir „City of Glass“ so gut gefallen hat. Und erzähl hier doch, wie du den visuellen Doppelgänger der anderen beiden Teile der New York Trilogie fandest. Ich bin noch so beglückt von „City of Glass“, dass ich erstmal eine Pause von den beiden weiteren Teilen brauche.
Pingback: